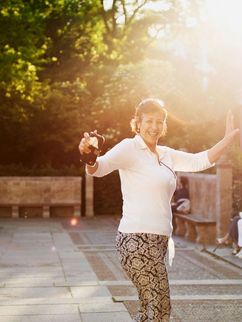Kleingärten und Gemeinschaftsgärten, Dachgärten oder mobile Beete in Kisten. Schrebergärten, Heimgärten, Lauben. Wie sie aussehen oder heißen, variiert. Das Prinzip aber ist dasselbe: Stadtbewohner gärtnern, säen, ernten. Dabei bewegen sie sich, begegnen einander, erholen sich. Der Anbau von Obst und Gemüse in der Stadt reicht zurück bis in die Zeit vor der Industrialisierung und erfuhr mit ihr einen deutlichen Schub. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg gärtnerten die meisten Bürger aus Notwendigkeit: Sie hatten Hunger.
Auch heute sind Krisenzeiten ein Treiber für das urbane Gärtnern, beobachtet Runrid Fox-Kämper. Im Aachener Büro des Instituts für Landes und Stadtentwicklungsforschung (ILS) leitet die Architektin ein Forschungsprojekt, in dem 170 Wissenschaftler aus 32 Ländern die Bedeutung von Gärten für Europas Städte und Menschen erkunden. Je schlechter die Zeiten, desto fleißiger wird gegärtnert. Dass urban gardening auch in Deutschland so beliebt ist, mag deshalb zunächst überraschen. Hierzulande schafft es heute kein Kleingärtner, sein Gemüse unter dem Preis der DiscountSupermärkte anzubauen. »Die Selbstversorgung ist nur eine Facette«, sagt Fox-Kämper. Das Gärtnern biete vor allem eine sinnvolle, identitätsstiftende Beschäftigung, unabhängig von Alter und Milieu.
Gartenanlagen verbessern das soziale Klima ganzer Viertel. Studien zeigen, dass sogar die Kriminalitätsrate mit der Beschaffenheit des öffentlichen Raums korreliert. In einem Viertel, in dem gesät und geerntet wird, fühlen sich die Menschen sicherer, sagt Fox-Kämper. Interessant sei beispielsweise, dass Gartenprojekte fast nie von Vandalismus betroffen sind, selbst in als problematisch geltenden Gegenden. Stattdessen verbessern sie häufig das Image eines Viertels.
Zum Beispiel in Aulnay-sous-Bois nordöstlich von Paris, wo man zwischen Plattenbauten kleine Gärten anlegte. Statt vom »Problemviertel« sprechen die Menschen jetzt von »dieser Gegend mit den schönen Gärten«. Im rheinlandpfälzischen Andernach hat man gleich die ganze Stadt »essbar« gemacht. Statt mit Zierpflanzen und Blumen bepflanzt die Stadt ihre öffentlichen Grünanlagen seit 2010 mit Artischocken, Kartoffeln, Mangold oder Walnussbäumen. Jeder darf dem Obst und Gemüse beim Wachsen zusehen und es am Ende ernten. »Pflücken erlaubt statt Betreten verboten«.
Die »Bunten Gärten am Moseberg« in Eisenach sind ein interkulturelles Projekt der Diako Westthüringen und der städtischen Wohnungsgesellschaft. Seit 2010 werden auf Parzellen Obst, Gemüse, Kräuter und Blumen angebaut. Mitmachen kann jeder. Das Ziel: das Gemeinwesen stärken, den Austausch zwischen Kulturen, Religionen und Generationen anregen — und dabei auch marginalisierte Randgruppen einbeziehen. Gerade für geflüchtete Menschen kann das gemeinschaftliche Gärtnern ein Weg in die Gesellschaft sein und ihrem Alltag einen Sinn geben, besonders in Zeiten der Arbeitsplatzsuche.
Früher hielten Städte ihre Armen vor allem aus einem Grund zum Gärtnern an: Sie sollten lernen, sich selbst zu versorgen. Ende des 18. Jahrhunderts teilte der bayerische Kriegsminister Rumford seinen Soldaten in München Parzellen im heutigen Englischen Garten zu und ließ sie auf einer Modellfarm in Landwirtschaft unterrichten. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts gründeten Fabrikbesitzer, Stadtverwaltungen und Wohlfahrtsorganisationen in ganz Deutschland Armen und Arbeitergärten. Die beiden Weltkriege brachten in den englischsprachigen Ländern die Ausdrücke war garden oder victory garden hervor. »Sow the seeds of Victory«, hielt man die Bürger auf Plakaten zum Gemüseanbau im eigenen Garten an.
Noch heute geht es vor allem außerhalb Europas häufig darum, wie Menschen in Krisensituationen mit wenig Land, wenig Arbeitsmaterialien und wenig Geld in kurzer Zeit Lebensmittel anbauen können. Das Leibniz-Institut für Gemüse und Zierpflanzenbau (IGZ) in Großbeeren beschäftigt sich mit dieser Frage. »Viele displaced persons sichern sich mit einem kleinen Gemüsegarten eine Nahrungsquelle oder schaffen eine erste Möglichkeit, Produkte für den Markt herzustellen«, sagt Eckhard George, der das Institut leitet.
Eine Idee: die Entwicklung eines »Starterpacks«, das hochwertiges Saatgut und Dünger enthält und so beispielsweise in den großen Flüchtlingslagern Malis und Syriens den Anbau erleichtern könnte. Wie die Eisenacher Flüchtlingsgärtner sind die Mitarbeiter des IGZ zudem in Deutschland aktiv geworden und haben mit weiteren Helfern geflüchteten Menschen in einer Notunterkunft in der Nachbarschaft des Instituts geholfen, einen Gemüsegarten anzulegen.
Der Wunsch, gemeinsam anzupacken und nicht nebeneinander herzuleben, hat die Gärten zurück in die Städte gebracht. Diese hoffen auf grünere Zentren, zufriedenere Bürger, mehr Touristen, weniger Kriminalität. Aber das urbane Gärtnern sei natürlich kein Allheilmittel, sagt Architektin Fox-Kämper vom ILS. Viele Fragen seien noch unerforscht. Zum Beispiel, ob urbane Gärten neben all den Vorzügen auch Schattenseiten haben — etwa indem sie die Gentrifizierung eines Viertels beschleunigen.