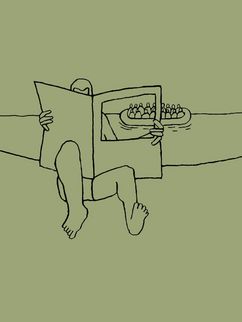Es war eine große Provokation, aber auch eine kleine Wahrheit. Das europäische Asylsystem, sagte die damalige EU-Innenkommissarin Anna Cecilia Malmström 2013, gleiche einer Lotterie. Mit ihrer Einschätzung steht Malmström nicht alleine da: Wer bleibt und wer gehen muss, ist in Europa nicht zuletzt Glückssache. Europaweit gilt das Dublin-Abkommen. Es legt fest, dass der Asylantrag im ersten »sicheren Drittstaat« gestellt werden muss, den ein Asylsuchender betritt. Ist das Deutschland, bestimmt der Königsteiner Schlüssel, in welchem Bundesland er unterkommt. Dieser berechnet sich zu zwei Dritteln nach der Steuerkraft des Bundeslandes und zu einem Drittel nach der Einwohnerzahl. Über die weitere Verteilung entscheiden die Landesbehörden.
Soweit die Theorie. Praktische Fragen stellten sich lange kaum. Die Flüchtlingszahlen sanken ab Mitte der 1990er Jahre. Erst mit ihrem Wiederanstieg erhitzte sich auch die Debatte um die Verteilung. Zunächst klingt es logisch, dass der Staat, der die Flüchtlinge versorgt, entscheidet, wer wo leben wird. Effizient und kurzfristig günstig scheint es, sie in ländlichen Regionen unterzubringen, wo die Mieten niedrig sind. Die meisten Zuwanderer streben aber in Städte, wo bereits Landsleute leben. Doch natürlich können dort nicht alle unterkommen — deshalb landen sie auch in den Dörfern und Kleinstädten Europas.
Aber ist dieses Vorgehen langfristig günstig für die Integration? »Für Phasen mit außergewöhnlich starker Flüchtlingsmigration«, sagt Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, »ist der Königsteiner Schlüssel eine vernünftige Sache.« Sobald geklärt ist, ob jemand bleiben darf, hält der Ökonom gesteuerte Verteilung aber nicht für die effizienteste Lösung. »Der Markt regelt das besser als die Behörde.« Wirkung zeige es eben gerade, wenn Geflüchtete dahin gehen, wo sie Gemeinschaften aus ihren Heimatländern vorfinden — sie fördern die Neuen mit Jobs und Alltagshilfe.
Felicitas Hillmann untersucht am Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung in Erkner, welche Bedeutung Migration für Städte hat. Sie sagt: »Für die Integration ist es zentral, dass die Geflüchteten nicht außerhalb der Gesellschaft untergebracht werden, wie das bei den Erstaufnahmeeinrichtungen in abgelegenen Kasernen oder Krankenhäusern häufig der Fall ist.« Nur wo Geflüchtete Zugang zu Arbeit, Bildung und sozialer Infrastruktur hätten, blieben sie auch langfristig. Diese Perspektiven sehen sie meist nur in Städten.
Oliver Holtemöller schlägt deshalb vor, das Prinzip der Verteilung umzudrehen. »Im Moment wollen die Regionen die Kosten niedrig halten«, sagt er. »Es wäre aber besser, wenn sie Anreize bekämen, für Zuwanderer attraktiver zu werden. Insbesondere für Regionen mit sinkenden Bevölkerungszahlen kann das sinnvoll sein.« Auch für Geflüchtete könnten ländliche Gebiete Vorteile haben, sagt Felicitas Hillmann: »Viele sind traumatisiert, sie wünschen sich kleinere, übersichtliche Gemeinschaften.«
Ein Blick zurück zeigt, wie man Integration fördern kann. Nach dem Zweiten Weltkrieg flohen mehrere Millionen Menschen nach Deutschland. Damals bestimmte die Militärregierung, wer wo wohnte. Einige Flüchtlinge verbrachten Jahre in Provisorien. Zwei Dinge hätten die Integration damals forciert, sagt Thomas Schlemmer vom Münchner Institut für Zeitgeschichte: umfangreiche Sozialprogramme für Altbürger und Flüchtlinge. Und ein wirtschaftlicher Aufschwung, dessen Bedeutung man gar nicht überschätzen könne. »Der Arbeitsmarkt war die große Integrationsmaschine für Migranten und Nichtmigranten.«
Zieht jeder Geflüchtete an seinen Wunschort, ist das kurzfristig teurer. »Aber die wirklichen Kosten sind nicht die Mieten«, sagt Oliver Holtemöller. »Teuer wird es, wenn ein Zwanzigjähriger herkommt und aufgrund unzureichender Integrationshilfen den Rest seines Lebens Transferempfänger bleibt.« Er ist überzeugt: Die Flüchtlingsbürokratie verursacht selbst unnötige Kosten. »Das Geld für die Beamten sollte man lieber für Kindergärten und Schulen verwenden.« Holtemöller plädiert deshalb wie viele Ökonomen für eine andere Verteilung. Wenn schon ein Schlüssel zum Einsatz komme, sollte er auch berücksichtigen, wie viele Ausländer in einer Region arbeitslos sind — diese Quote sei für die Integrationschancen aussagekräftiger.
Dass diese Idee bald politische Realität wird, ist unwahrscheinlich. Im Mai hat die Große Koalition eine neue Wohnsitzregelung beschlossen: Wer Hilfe vom Staat bezieht, muss in dem Bundesland leben, das ihm zuerst zugewiesen wurde. Und dort auch bleiben — bis zu drei Jahre über das Ende seines Anerkennungsverfahrens hinaus.
NOSHE
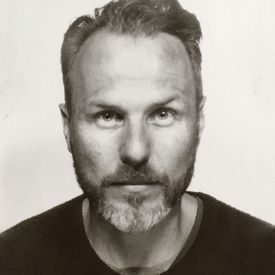
Für seine Bildserie Arrival
hat ANDREAS GERKE provisorische Notunterkünfte für Geflüchtete in Berlin dokumentiert. Seine Arbeit wurde 2017 mit dem Europäischen Architekturfotografie-Preis Architekturbild
ausgezeichnet. Weitere Bilder des Fotografen gibt es unter www.noshe.com.