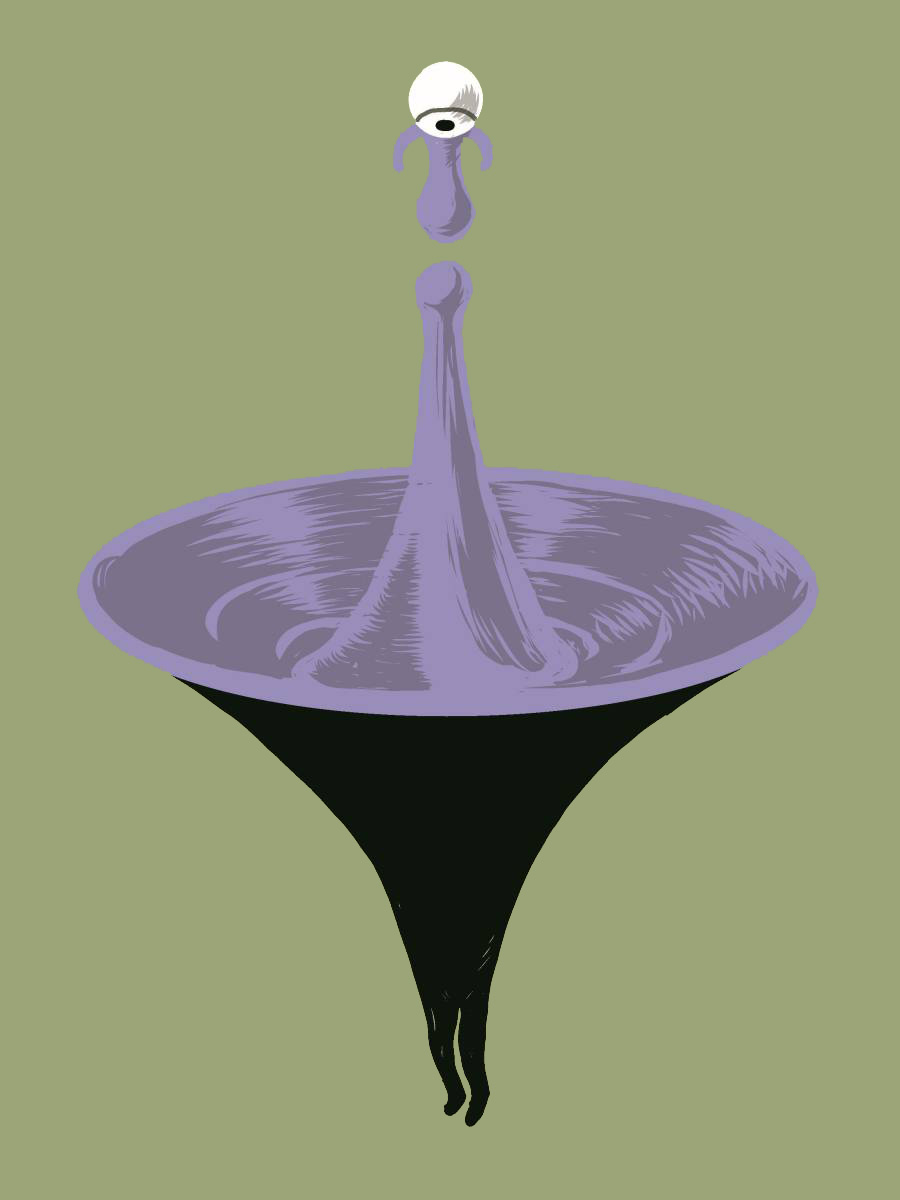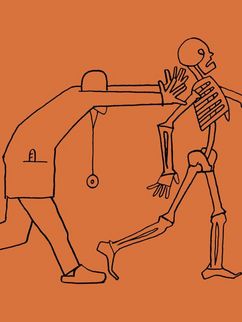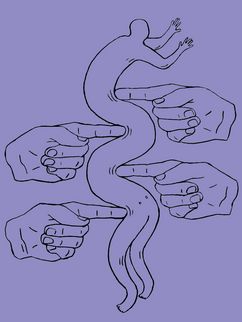Wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun. So in etwa lautete die Schlussfolgerung von Hirnforschern und Philosophen, als der US-amerikanische Neurophysiologe Benjamin Libet Anfang der 1980er Jahre die Ergebnisse seines als »Libet-Experiment« bekannt gewordenen Versuchs veröffentlichte.
Bereits 1965 hatten die deutschen Neurologen Lüder Deecke und Hans Helmut Kornhuber beobachtet, dass sich das menschliche Gehirn schon etwa 500 Millisekunden vor einer körperlichen Bewegung auf deren Ausführung vorbereitet. Bereitschaftspotenzial nannten sie ihre Entdeckung. Libet erweiterte das Experiment und untersuchte zusätzlich den Zeitpunkt, an dem wir uns bewusst entscheiden, eine Bewegung auszuführen. Er fand heraus, dass das Bereitschaftspotenzial schon vor diesem Moment beginnt — und löste damit eine erregte Debatte aus: Nicht das Ich, sondern das Gehirn trifft unsere Entscheidungen! Mehrere Studien später hat sich diese Interpretation zwar relativiert, doch bis heute ist die Frage eine der meistdiskutierten in der Philosophie: Wie frei ist der menschliche Wille wirklich?
Wie man sie beantwortet, hängt auch davon ab, wie man (Willens-)Freiheit definiert. Für Frank W. Ohl vom Leibniz-Institut für Neurobiologie (LIN) verbirgt sich dahinter eine grundlegende philosophische Frage: Lässt sich die Vorstellung eines freien Willens mit einem deterministischen Weltbild in Einklang bringen? Also mit der Annahme, dass alles, was geschieht, eine Ursache hat? Ohl leitet am LIN die Abteilung »Systemphysiologie des Lernens« und ist Sprecher des Sonderforschungsbereiches »Neurobiologie motivierten Verhaltens« der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).
Willensfreiheit und Determinismus schließen sich für den Motivationsforscher nicht aus. »Freiheit impliziert nicht, dass unser Wollen in einem bedingungslosen Raum stattfindet«, sagt er. Ohl hält es dabei mit John Locke. Der englische Philosoph beschrieb Willensfreiheit schon im 17. Jahrhundert als die Möglichkeit, vor jeder Willenshandlung innezuhalten, ihre Konsequenzen abzuwägen und auch die Freiheit zu haben, etwas nicht zu tun, als eine Art inneres Vetorecht also. Ein Wille dagegen, der nicht durch Motive geleitet wird, sei nichts anderes als Zufall.
Das Ich oder das Gehirn — wer trifft die Entscheidung?
Unser Wille entsteht also nicht im luftleeren Raum. Entscheidungen zu treffen, ist immer auch eine Frage der Rahmenbedingungen. Im »Vakuum« wissen wir ziemlich genau, was wir wollen und was gut für uns ist. Doch äußere Reize und Gegebenheiten führen häufig dazu, dass wir entgegen unserer Präferenzen und langfristigen Ziele handeln.
Davon geht auch Peter N.C. Mohr vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) aus. An dem Leibniz-Institut und am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Freien Universität Berlin leitet er die Nachwuchsgruppe »Neuroökonomie«. Sie untersucht unter anderem, wie Menschen riskante ökonomische Situationen erleben, und wie sie finanzielle Entscheidungen treffen.
Da ist etwa das kleine Fenster in der Steuersoftware, das den Betrag anzeigt, den uns das Finanzamt voraussichtlich zurückerstattet — und so nicht nur unser Moralempfinden beeinflussen, sondern sogar Steuerhinterziehung begünstigen könnte. Abhängig von den Daten, die wir eingeben, variiert der Betrag in Echtzeit.
»Das kann uns dazu verleiten, es mit den Angaben nicht immer so genau zu nehmen«, erklärt Mohr. Wie kann ich den höchstmöglichen Betrag herausholen? Diese Frage hat sich vermutlich jeder schon einmal gestellt. Sind dazu noch unsere Daten aus dem Vorjahr gespeichert, ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir sie für das Folgejahr übernehmen — auch wenn sie nicht mehr stimmen. Welche Steuererklärungen sollten die Finanzämter also genauer prüfen? Der Staat könne dieses Wissen etwa für ein besseres Risikomanagement nutzen, sagt Mohr.
Auch deshalb beschäftigt er sich mit dem Thema nudging. Nudges, das sind leichte Schubser, die Menschen mittels psychologischer Mechanismen anregen sollen, bestimmte Entscheidungen zu treffen — und zwar ohne, dass sie sich der Verhaltenssteuerung unmittelbar bewusst sind. Das sind zum Beispiel Warnhinweise auf Zigarettenschachteln oder die etwa in Österreich geltende Widerspruchslösung bei der Organspende.
Für Mohr ist nudging nicht mehr als ein Modebegriff. Letztlich gehe es dabei immer um die Frage, ob eine Verhaltensbeeinflussung gerechtfertigt sei oder nicht. Wenn es nach ihm ginge, sollte die Politik die Bürger in allen Lebensbereichen dabei unterstützen, mit ihren Entscheidungen möglichst nah bei dem anzukommen, was sie wirklich wollen. Ein Antrag auf Elterngeld etwa dürfe nicht so kompliziert sein, dass man sich allein aus Überforderung dagegen entscheidet, ihn auszufüllen. Der Mensch sei »von Natur aus komplexitätsavers«, so Mohr.
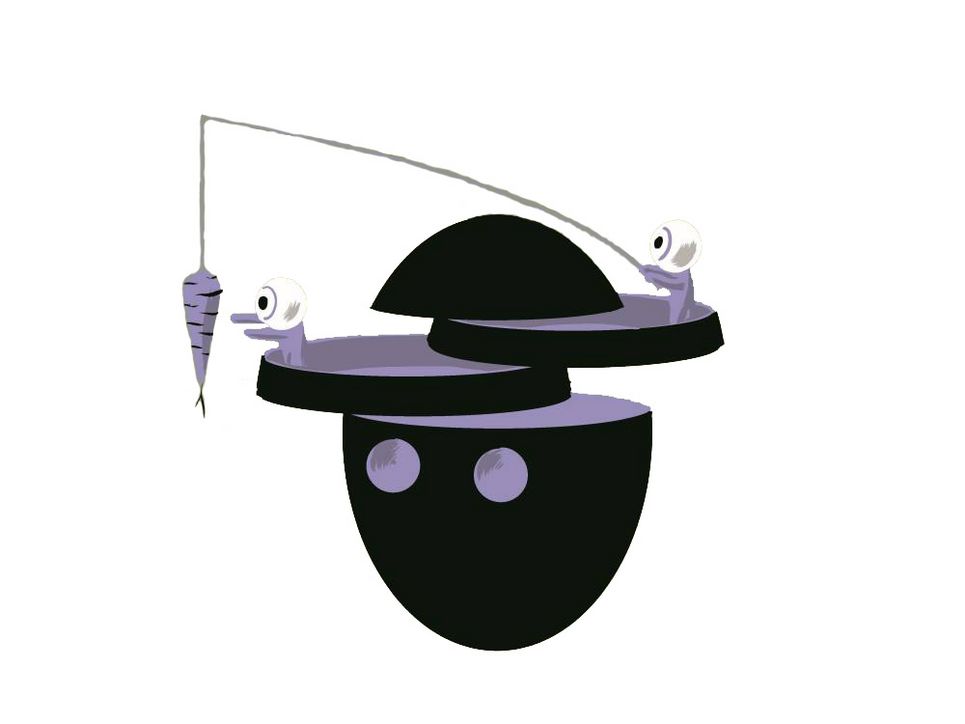
Für Frank W. Ohl vom LIN haben viele neuroökonomische Ansätze eine entscheidende Schwäche. Zwar gehe man in den Wirtschaftswissenschaften nicht mehr von einem homo oeconomicus aus, einem rational handelnden Individuum, das seine Entscheidungen allein vom zu erwartenden Nutzen abhängig macht. Doch weise die Mehrheit der Modelle dem Menschen Wertvorstellungen zu, die zwar von äußeren Bedingungen beeinflusst werden, aber an sich statisch seien. »Individuen sind aber keine Automaten, sondern sich permanent verändernde Systeme.«
Ohl untersucht deshalb, wie unser Gehirn aus Verhaltensentscheidungen und deren Konsequenzen lernt. Sind wir bereit, für die Aussicht auf einen Gewinn eine Strafe zu riskieren? Oder gehen wir auf Nummer sicher und verzichten auf die Belohnung? Ob wir ein risikofreudiger oder ein konservativer Entscheider sind, kann sich durch frühere Erfahrungen verändern.
Im Gehirn sind dafür zwei Gegenspieler verantwortlich: das ventrale tegmentale Areal und der laterale Hypothalamus. Im Tierexperiment können Forscher die beiden Kontrollsysteme durch elektrische Stimulation gezielt manipulieren und so die Verhaltensstrategie der Tiere ändern. Dazu werden ihnen schmerzfrei Elektroden implantiert. In einem simulierten Belohnungs- und Bestrafungsszenario werden so aus vorsichtigen risikobereite Nager und umgekehrt.
Beim Menschen wäre eine Manipulation auf Ebene dieser »Schaltkreise« nicht nur technisch viel schwieriger, sondern auch moralisch höchst fragwürdig. Dennoch lassen sich die Erkenntnisse auf das menschliche Gehirn übertragen, etwa durch die Anwendung von Neuropharmaka. Sie können etwa die Ausschüttung von Dopamin steigern, ein Hormon, das nicht nur glücklich, sondern auch risikofreudig macht.
Doch was, wenn wir eines Tages nicht mehr nur mit Medikamenten in unser biochemisches System eingreifen können? Schon jetzt beschreiben dystopische Visionen wie die des Historikers Yuval Noah Harari in »Homo Deus« eine Zukunft, in der Biotechnologie und Künstliche Intelligenz unserem freien Willen endgültig ein Ende setzen. Eine Zukunft, in der der Einzelne nicht mehr als Individuum in Erscheinung tritt, sondern als bloße Ansammlung biochemischer Algorithmen, die sich spielend leicht manipulieren lassen.
Die Folge: ein biologisches Kastensystem, in dem eine kleine Elite optimierter Übermenschen mit völlig neuen physischen und geistigen Fähigkeiten über den Rest der Menschheit herrscht. Der freie Wille wäre dann lediglich ein philosophisches Konstrukt aus vergangenen Zeiten.