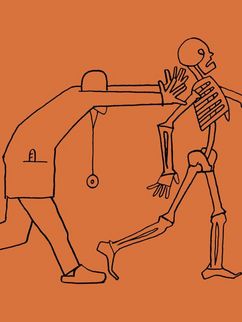Pro
Dass es bei unserer Arbeit um Menschenleben gehen kann, zeigt das Beispiel des Antirheumatikums »Rofecoxib«. Es wird geschätzt, dass während seiner fünfjährigen Vermarktungsdauer in den USA mindestens 88.000 Herzinfarkte auf das Medikament zurückgingen. Immer wieder werden Arzneimittel wie »Rofecoxib«, deren schwerwiegende Nebenwirkungen erst nach der Zulassung erkannt werden, wieder vom Markt genommen. Wenn sie erkannt werden — was in Deutschland ungleich schwieriger ist als in den USA.
Bevor ein Medikament zugelassen wird, müssen klinische Studien seine Wirksamkeit nachweisen. Diese Studien werden nur über einen begrenzten Zeitraum und in einer kleinen, selektiven Population durchgeführt, häufig Männer im jungen und mittleren Erwachsenenalter. Hat ein Medikament Nebenwirkungen, die wie Tumore erst nach längerer Zeit oder nur selten auftreten, können sie in diesen Studien nicht erkannt werden. Die Nebenwirkungen zeigen sich dann häufig erst im Alltagsgebrauch — also nach der Zulassung.
Mithilfe von Abrechnungsdaten von Sozialleistungsträgern wie Krankenkassen können wir Arzneimittel nach der Zulassung überwachen und gesundheitsbedrohliche Nebenwirkungen erkennen. Für unser Institut sind sie eine unverzichtbare Ressource, insbesondere für die Arzneimittelrisikoforschung. Abrechnungsdaten gehören zu den sogenannten personenbezogenen Sozialdaten. Unter gesetzlich klar geregelten Rahmenbedingungen können sie der Forschung zur Verfügung gestellt werden.
Dem offensichtlichen Nutzen der wissenschaftlichen Analyse solcher Sozialdaten steht der berechtigte Anspruch der Betroffenen auf Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte gegenüber. Beides muss in eine vernünftige Balance gebracht werden. Die gesetzlichen Regelungen zum Umgang mit Sozialdaten sind in Deutschland vergleichsweise restriktiv. Zur Übermittlung in die Wissenschaft muss für jedes einzelne Forschungsvorhaben unter Angabe eines Datenschutzkonzeptes ein Antrag gestellt werden. Die Daten werden in einer unabhängigen Vertrauensstelle pseudonymisiert, so dass den Daten keine Namen mehr zugeordnet sind. Nach Abschluss des Projekts muss der gesamte Datensatz gelöscht werden.
Die Persönlichkeitsrechte der Versicherten werden auf diese Weise geschützt. Und dieser Schutz muss ohne Zweifel erhalten bleiben. Für eine langfristige Überwachung von Arzneimitteln nach der Zulassung ist die aktuelle gesetzliche Regelung jedoch ungeeignet.
Besonders die zeitliche Begrenzung der Datenspeicherung verhindert die Untersuchung von Spätfolgen. Auch die Projektbindung und die Benennung einer konkreten Forschungsfrage im Vorhinein sind problematisch, da Arzneimittelnebenwirkungen nicht prognostiziert werden können. Vor allem dann nicht, wenn das Medikament noch nicht zugelassen ist.
Daher brauchen wir dringend eine Novellierung des betreffenden § 75 im Sozialgesetzbuch X, damit wir eine pseudonymisierte longitudinale Forschungsdatenbank aufbauen können, die unabhängig von konkreten Fragestellungen geführt wird. Teil einer neuen gesetzlichen Regelung sollte dann auch ein »Forschungsgeheimnis« sein, das die nachträgliche Zuordnung von Daten zu Personen unter Strafe stellt. Bricht ein Arzt seine ärztliche Schweigepflicht, wird er strafrechtlich belangt. Das muss analog auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gelten, wenn sie personenbezogene Details preisgeben.
Die datenschutzkonforme Verwendung von Sozialdaten in der Forschung an sich kann und darf meiner Meinung nach aber nicht in Frage gestellt werden. Wir leben in einer Solidargemeinschaft. Wenn meine persönlichen Daten zum Wohle der Bevölkerung beitragen und Leben retten können, ist ein striktes »Nein« zu deren Verwendung nicht nur falsch — es ist unmoralisch.
IRIS PIGEOT ist Direktorin des Leibniz-Instituts für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS in Bremen.
Contra
Am 19. Januar 2013 besuchte ich meinen Hausarzt am Arkonaplatz in Berlin. Die Praxis erhielt für meine Behandlung 45,58 Euro und als Diagnose wurde »J.40« festgehalten. »J.40« bedeutet in der internationalen Klassifikation für Krankheiten und verwandte Gesundheitsprobleme (ICD) eine nicht chronische Bronchitis. Diese Information habe ich nicht selber in mein Tagebuch notiert, meine Krankenkasse hat sie mir auf Anfrage geschickt: fünf ausgedruckte Seiten mit allen Arztbesuchen und Diagnosen über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren.
Gesundheitsdaten existieren als handschriftliche Kartei in Arztpraxen, aber auch auf den Computern des Arztes und bei den Krankenkassen. Sie erzählen Krankheitsgeschichten und -verläufe umfassend. Sie ermöglichen es aber auch, Menschen genau zu kategorisieren, sexuelle Vorlieben oder psychische Probleme herauszufinden. Werden diese Daten öffentlich, können sie das Leben eines Menschen ruinieren — privat und beruflich.
Ich finde es deshalb falsch, dass diese Informationen in diesem Umfang bei meiner Krankenkasse liegen. Ich finde es falsch, wie technisch unsicher diese Daten in vielen Arztpraxen aufbewahrt werden. Und ich finde es falsch, wenn Wissenschaftler auf diese riesigen Datenberge ohne die Einwilligung der Betroffenen, also potentiell jedem von uns, Zugriff erhalten. Denn die Gefahr von Datenlecks, der missbräuchlichen Nutzung, der Rückidentifizierung von Einzelnen und der weiteren Verbreitung wächst, je mehr Personen und Stellen darauf Zugriff haben.
Hinzu kommt, dass der Standard der Datensicherheit an vielen Hochschulen und Forschungseinrichtungen noch nicht hoch genug ist. Bequemlichkeit oder fehlende finanzielle Möglichkeiten führen zu Abstrichen bei der sicheren Verarbeitung und Speicherung von Daten. Sicherheitsdatenzentren gibt es selten und die Systeme und Arbeitsplätze, an denen diese Daten ausgewertet werden, sind oft an das Internet angeschlossen.
Ich sehe eine große Chance darin, medizinische Forschung und die Gesundheitsversorgung durch die Analyse von großen Mengen von Gesundheitsdaten zu verbessern. Wir brauchen diese Forschung. Ich bin aber dagegen, wenn Daten ohne Kenntnis und Einwilligung der Betroffenen weitergegeben werden.
Wir brauchen einen alternativen Ansatz. Wir müssen die beste IT-Sicherheitsstruktur schaffen und deren Nutzung in der Praxis durchsetzen. Es muss Aufklärung betrieben werden, wer wozu und für wen forscht, um das nötige Vertrauen bei den Menschen aufzubauen. Nur das ermöglicht ihre echte Einwilligung und eröffnet jeder und jedem von uns die Möglichkeit, der Wissenschaft Gesundheitsdaten für Forschungszwecke zu spenden.
Wer bereit ist, die Wissenschaft mit so einer Datenspende zu unterstützen, sollte selbst festlegen können, wer sie wie auswerten darf — seien es Diagnosen, Verschreibungen oder auch Daten aus medizinischen Geräten und Fitnessarmbändern. Vielleicht kommen wir zu einem standardisierten Datenaustauschsystem mit offenen Lizenzen und einer öffentlichen Aufmerksamkeit wie etwa beim Organspendeausweis. Dort ist jeder informiert, kann selbst Risiken und Vorteile abwägen und dann eine selbstbestimmte Entscheidung treffen.
Daher ein »Ja« zur medizinischen Forschung in einem technisch sicheren Umfeld. Aber ein »Nein« zum Zugriff durch die Hintertür, von dem der Einzelne nichts weiß, in den er nicht einwilligt und bei dem Forschungseinrichtungen, Krankenkassen oder andere Daten im Unbekannten austauschen.
MALTE SPITZ ist Politiker, Aktivist und Datenschützer.