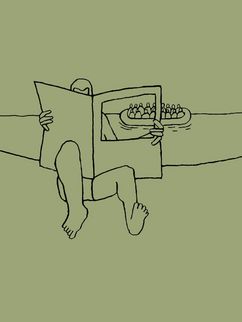Flächenbrand, Staatszerfall, der Nahe Osten im Chaos. Wer das jordanische Städtchen Ramtha an der syrischen Grenze besucht und einen Ort im Ausnahmezustand erwartet, wird sich wundern: Auf einer Grünfläche spielen Kinder Fußball, auf dem Bahhara-Souk bieten Marktverkäufer Plastiklatschen und Handyhüllen feil und unweit der jüngst in die Höhe gezogenen Apartment-Blocks haben sich die ersten Restaurants und Süßigkeitenhändler angesiedelt.
Wo ist der blutige Krieg, der wenige hundert Meter entfernt hinter dem Grenzzaun wütet?
Man könnte meinen, er mache an der Grenze halt. Die Kampfjets kehren um, bevor sie den jordanischen Luftraum verletzen. Die Kämpfer bleiben in Syrien. Und auch die Mörsergranaten fliegen zu selten über die Grenze, als dass sie die Bewohner Ramthas ernsthaft beunruhigen würden.
Ein Krieg, der einfach an der Grenze halt macht? Yazan Doughan zieht die Augenbrauen zusammen. Der Ethnologe sieht müde aus. Erst vor einigen Stunden ist er mit seinem Kollegen, dem Politologen André Bank, aus der 90 Kilometer entfernten Hauptstadt Amman in Ramtha angekommen. Die beiden Wissenschaftler vom Hamburger Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien (GIGA) besuchen den Norden Jordaniens.
Dort haben die Vereinten Nationen mit Zaatari eines der größten Flüchtlingslager der Welt errichtet. Was Hunderttausende Schutzsuchende aber nicht davon abhält, in die Dörfer und Städte der Region zu drängen und sich unter die Einheimischen zu mischen. »Krieg«, sagt Doughan nach einer kurzen Denkpause, »ist nichts, was in einem bestimmten Territorium herrscht und dann an der Grenze einfach aufhört.« Klar, die Gefechte schon. Die Bomben auch. »Aber wir können Krieg nicht auf bewaffnete Kämpfe und Gewalt reduzieren.«
Was macht Krieg, wenn er nicht zerstört? Wenn er nicht tötet? Was bedeutet der Krieg für Ramthas Bewohner, die die Schüsse und Bomben in Syrien zwar hören, aber letztlich doch in Frieden leben?
Nusra-Front, IS, Freie Syrische Armee — ich habe keine Ahnung!
IBRAHIM AL-SAQQAR

Yazan Doughan und André Bank steuern ihren Wagen durch die belebten Straßen. Sie fahren kreuz und quer durch Ramtha, um sich über Grenzhandel und Drogenschmuggel zu informieren. Abgesehen von Flüchtlingen und NGO-Mitarbeitern verschlägt es nicht viele Besucher in das kleine Städtchen. Etwas fremd wirken die Wissenschaftler mit ihren Notizbüchern unterm Arm, als sie in das Gedränge auf dem Bahhara-Souk eintauchen.
In einem alten Einkaufszentrum finden sie die baladiya, die Stadtverwaltung Ramthas. Die Geschäfte sind geschlossen, die Fenster verriegelt, aus den Wänden hängen lose Kabel. Leere Kaffeebecher säumen den Weg hinauf ins Büro des Bürgermeisters. Einzig der massive Holzschreibtisch von Ibrahim al-Saqqar macht etwas her, auch wenn er mit der kleinen Flagge, dem Namensschild und den obligatorischen Kleenex-Taschentüchern in jeder Bürokratenstube der arabischen Welt stehen könnte. Auch ein Foto des Staatsoberhaupts fehlt nicht: König Abdallah II., mit aufgeschlagenem Koran.
»Nusra-Front, Islamischer Staat, Freie Syrische Armee — ich habe keine Ahnung!«, ruft Bürgermeister Saqqar. Woher solle er wissen, wer den Grenzübergang zu seinem Ort auf syrischer Seite kontrolliere? Das wechsle fast täglich. Die Probleme, die Herrn Saqqar plagen, sind anderer Natur. Der Müll zum Beispiel. Mit den Flüchtlingen aus Syrien, die die Bevölkerungszahl Ramthas verdoppelt haben, sei die Müllabfuhr heillos überfordert. Früher hätten die Leute 50 Tonnen Müll am Tag produziert, heute seien es 100, an manchen Tagen 120.
Als habe er eine Checkliste abzuarbeiten, springt Saqqar zum nächsten Problem: Wie sollen die vielen neuen Bewohner mit Trinkwasser versorgt werden? Die Stadt komme nicht hinterher mit all den Infrastrukturprojekten, die eigentlich nötig wären. Und nicht zuletzt sei da die Arbeitslosigkeit: Sie habe sich verdreifacht, klagt Saqqar, liege jetzt bei 45 Prozent.
Zu viel Müll, zu wenig Wasser und immer mehr Arbeitslose. Ist das der Krieg, dem Doughan und Bank in Ramtha auf die Spur kommen wollen? Sieht so der »Syrienkrieg in Jordanien« aus, wie das Hamburger Forschungsprojekt »Neben-Kriegsschauplätze« im Untertitel heißt?
Auf den Bindestrich in »Neben-Kriegsschauplätze« besteht Bank. So lässt sich der Titel direkt verstehen, also örtlich. Aber eben auch als Kritik an Journalisten und Wissenschaftlern, die immer nur dort hinschauen, wo Gewalt offen zu Tage tritt. Doughan und Bank wollen das Hauptaugenmerk stattdessen auf einen Nebenschauplatz legen. »Kriege wirken nicht nur da, wo Gewalt herrscht«, sagt Bank. »Sie entfalten auch starke transformative Wirkung in der direkten Nachbarschaft.«


In der Nachbarschaft liegt Ramtha allemal. Gleich hinterm Grenzzaun, im südsyrischen Deraa, nahm der Aufstand gegen Diktator Baschar al-Assad im März 2011 seinen Ausgang. Alte Bande, familiäre Verflechtungen und Geschäftsbeziehungen verbinden die beiden Orte. Lange florierte der Handel, Ramtha profitierte. Heute ist die Grenze zu. Wie Mahnmale stehen überall in der Stadt ausrangierte Lastwagen am Wegesrand, die einst Waren von und nach Damaskus brachten.
Grenzstädte wie Ramtha hat die Krise im Nachbarland besonders hart getroffen, aber die Arbeitslosigkeit steigt in ganz Jordanien. Deshalb darf der Großteil der syrischen Flüchtlinge offiziell nicht arbeiten. König Abdallah II. weiß: Den Arbeitsmarkt für die Neuankömmlinge zu öffnen, ohne gleichzeitig für die vielen bedürftigen Jordanier zu sorgen, wäre in dem ressourcenarmen Land riskant. Aber der Schwarzmarkt boomt. »In vielen Unternehmen arbeiten Syrer für ein Fünftel oder Sechstel des üblichen Lohns«, sagt Bank.
Wie viele Syrer seit 2011 ins Land gekommen sind, weiß wohl selbst die Regierung in Amman nicht so genau. Knapp 689.100 Personen hat das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen registriert. Der König sprach jüngst von 1,4 Millionen, Zeitungen schreiben gar von 2 Millionen. »Politik der Zahlen« nennt Bank das Geschacher. »Jordanien ist stark außenabhängig«, erklärt er, »mit den Flüchtlingszahlen wird versucht, Gelder zu akquirieren.« Je desolater die Lage, desto besser ist Ammans Verhandlungsposition auf internationalem Parkett.
Denn wenn Angela Merkel oder Frank-Walter Steinmeier predigen, dass die Fluchtursachen bekämpft und die Aufnahmeländer gestärkt werden müssen, dann ist neben der Türkei und dem Libanon vor allem Jordanien gemeint. Im Februar erst trafen sich 70 Regierungsdelegationen in London, um Milliardenhilfen für Syriens Nachbarstaaten zu organisieren. Die Jordanier seien an der Grenze ihrer Belastbarkeit angekommen, diktierte König Abdallah II. pünktlich zu Konferenzbeginn einer BBC-Reporterin ins Mikrofon.
»Früher oder später wird der Damm brechen.« Dann schob er hinterher: »Diese Woche ist sehr wichtig für die Jordanier. Sie werden sehen, ob es Hilfe geben wird — nicht nur für die syrischen Flüchtlinge, sondern auch für ihre eigene Zukunft.«

Mit Zusagen für mehrere Milliarden Euro kehrte der König zurück. »Eine signifikante Summe für ein Land, das insgesamt mit rund 10 bis 15 Milliarden Euro pro Jahr haushaltet«, meint Bank, der für das Gefeilsche des Königs Verständnis hat: »Die Ansprüche sind legitim, wenn man bedenkt, was Jordanien im Vergleich zu wohlhabenderen Ländern geleistet hat.« Hilfe aus dem Ausland hat auch die Müllabfuhr in Ramtha vor dem Kollaps bewahrt. Ihr fehlte es nicht nur an Arbeitern, sondern vor allem an Müllautos. Schließlich spendete die Entwicklungsbehörde USAID einige Fahrzeuge. »Das hat die Krise entschärft«, sagt Bürgermeister Saqqar. Auch seine eigene Behörde profitierte vom Engagement der Amerikaner. Auf dem Pickup-Truck der Stadtverwaltung, mit dem die Gäste nach dem Gespräch durch Ramtha gefahren werden, prangt das USAID-Logo in den Farben der amerikanischen Nationalflagge.
Auch politisch schlägt Jordanien aus der Krise in der Region Kapital. »Durch den Syrienkrieg hat es an geostrategischer Bedeutung gewonnen«, sagt Bank. Mit Syrien und dem Irak grenzt das Königreich an zwei Bürgerkriegsländer, der Libanon ist chronisch instabil und in direkter Nachbarschaft liegen Israelis und Palästinenser im Clinch. Weder das saudische Königshaus noch Israel, Europa oder die USA haben ein Interesse daran, dass die pro-westliche jordanische Monarchie ins Wanken gerät. Deshalb, sagt Bank, fließe auch kräftig Militärhilfe ins Land. Erst im vergangenen Sommer wurde bekannt, dass Israel Jordanien 16 Cobra-Kampfhubschrauber schenkte, um den arabischen Nachbarn im Kampf gegen Unruhestifter wie die Dschihadisten des Islamischen Staats zu unterstützen.
Doch so geschickt Amman die Krise in der Region zu nutzen versucht, für das Königreich bleibt der Flüchtlingsstrom eine Herausforderung. Der Pickup-Truck der Stadtverwaltung hält vor einem großen Tor am Rande Ramthas. Wo einst ein öffentlicher Park mit Grünflächen und Kinderspielplatz entstehen sollte, reiht sich nun ein Flüchtlingszelt ans nächste. Ramthas Camp ist eines der kleinen Lager Jordaniens, nicht zu vergleichen mit Zaatari, das im fünften Jahr des Syrienkriegs eher einer festen Siedlung gleicht als einem Zeltlager. Doch Zaatari leert sich. Kaum ein Syrer fristet sein Dasein freiwillig in den trostlosen Container- und Zelt-Landschaften der Camps. Wer kann, geht in die Städte. Nach Amman, Ramtha oder ins unweit von Zaatari gelegene Mafraq.

Die Lage ist schwer zu überblicken, die Zahlen variieren stark. Ein Anfang des Jahres veröffentlichter Zensus ergab, dass mittlerweile mehr als 13 Prozent der rund 9 Millionen Einwohner Jordaniens Syrer sind. Auf die Bevölkerung Deutschlands hochgerechnet wären das mehr als 10 Millionen Syrienflüchtlinge. Trotzdem fasst in Jordanien keine breite, fremdenfeindliche Bewegung Fuß. Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte gibt es nicht, zu Gewalt gegen Syrer kam es nur vereinzelt.
Ressentiments gegen die Flüchtlinge gibt es dennoch: Die Syrer nähmen die Arbeitsplätze weg, verbrauchten zu viel Wasser, trieben die Mieten in die Höhe. »Früher gab es bei uns keine Kriminalität«, meint Taleb K., der in Amman ein Hotel betreibt. »Jetzt muss ich mein Auto abschließen, auch wenn ich nur kurz beim Bäcker stoppe.« Vorurteile sind vor allem über die Syrerinnen verbreitet. Flüchtlingsmädchen und -frauen gelten als billig, als Prostituierte. »Du kannst jedes syrische Mädchen heiraten«, ist Taleb K. überzeugt. »Sie machen alles, um aus den Lagern zu kommen. Das Alter spielt keine Rolle.«
Dass Geschichten wie diese im Land kursieren, die Stimmung sich insgesamt aber nicht gegen die Syrer wendet, hat auch mit Jordaniens Geschichte zu tun. Das Königreich ist ein Land mit Migrationshintergrund. Viele antworten auf die Frage nach ihrer Herkunft: min asl falastini — ursprünglich palästinensisch. Nach der Gründung Israels 1948 und der Vertreibung Hunderttausender Palästinenser flüchteten sich Zehntausende über den Jordan, mit der Besetzung des Westjordanlands 1967 kam eine noch größere Welle. »Wie kann ich gegen die Flüchtlinge sein, meine Familie ist selbst aus Palästina«, sagt ein Ladenbesitzer in Amman, einer fast gänzlich palästinensischen Stadt.
Doch die Einwanderungsgeschichte hat auch ihre Kehrseite, sagt Yazan Doughan. Während sie zu einer gewissen Gelassenheit führe, sei es ebendiese Erfahrung mit Flüchtlingen, aus der sich heute die Ängste speisen. »1970 kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der jordanischen Armee und palästinensischen Einwanderern«, erklärt Doughan. Das warf die Frage auf, wer ein »echter« Jordanier sei. »Seither herrscht unter nationalistischen Jordaniern die Angst, dass Nicht-Jordanier eines Tages den Staat übernehmen könnten.« Staat und Nation, ja die jordanische Identität schlechthin, seien demnach durch Flüchtlinge bedroht. »Die Angst, dass sie die Kontrolle über das Land an sich reißen, spürt man bei jeder neuen Welle, die Jordanien erreicht«, beobachtet Doughan.
Von dieser Angst berichtet auch Bürgermeister Ibrahim al-Saqqar in Ramtha. »Am Anfang dachten wir, die Krise in Syrien würde schnell vorbeigehen«, sagt er, »aber die Syrer werden bleiben.« Selbst wenn der Krieg heute enden würde, bräuchte es wohl Jahre, bis das Nachbarland sich auch wirtschaftlich wieder erholt. Mit jedem Geschäft, das Syrer in der Stadt eröffnen, erzählt Saqqar, wachse die Angst, dass die Neuen zu reich werden und die Jordanier eines Tages im eigenen Land für sie arbeiten müssen.
Der Mitarbeiter des Bürgermeisters, der die Gäste aus Deutschland durch Ramtha fährt, kurbelt die Scheibe des Pickups herunter. Während er im Schritttempo Ramthas belebte Hauptstraße entlangrollt, vorbei an neu eröffneten Handyshops, Restaurants und Süßwarenläden, kommentiert er: »Syrer, Syrer, Syrer.« Er sagt es nicht abwertend, sondern fast ein wenig stolz. »Etwas Gutes hat die Krise da drüben jedenfalls: Noch nie gab es so viele gute Süßigkeiten in Jordanien wie in diesen Tagen.«