Die Zukunft beginnt an einem Samstagmorgen um drei Uhr in der Schule. 25 Fischer aus den Dörfern Marumbi, Chwaka und Uroa treffen ein und setzen sich auf die Bänke. Längst ist die Sonne aufgegangen und hat den Sandboden an der Ostküste Sansibars erhitzt. Vögel und Zikaden künden vom Tag, den die Fischer hier ab Sonnenaufgang zählen. Wenn sich die Kinder in Europa um sieben Uhr auf den Weg in die Schule machen, schlägt auf der äquatornahen Insel die Stunde eins.
Die Schüler haben frei am Samstag, das Gebäude ist heute Treffpunkt für ihre Väter und Großväter. Normalerweise sind die um diese Zeit in der Chwaka Bay auf ihren Fischerbooten. Heute diskutieren sie. Über die zu kleinen Fische, die sie aus dem Meer holen, über die Frage, was sie damit zu tun haben. Und über das, was sie tun müssen, um die Überfischung zu stoppen, damit die Bucht auch noch ihre Kinder und Enkel ernähren kann.
Alle Fischer, die sie zu diesem Treffen eingeladen habe, seien erschienen, sagt Jennifer Rehren. Sie wüssten, dass sie ein Problem haben. Da draußen, im Meer, von dem sie abhängen. Rehren hat diesem Problem ihre Doktorarbeit gewidmet, die grundlegende Daten für die Diskussion liefert. »Die meisten Fischer wissen, dass sie zu seiner Lösung beitragen müssen«, erklärt die Biologin vom Bremer Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT). »Bleibt die Frage: Warum ändert das nichts?«
Erste Versuche, die Fischerei in der Gegend nachhaltiger zu gestalten, sind gescheitert. Da war das Verbot der Speere, moderner Harpunen, die mit hohem Druck abgeschossen werden und oft erhebliche Schäden an den Riffen hinterlassen. Und das der Schleppnetze, die die Fischer Chwakas von Booten aus hinter sich herziehen. Die Netze schädigen den Meeresboden, die Seegraswiesen, die Korallenriffe und zerstören die natürlichen Habitate der Fische. »Aber weil die Aufforderung der Behörden, vor allem die Schleppnetze durch nachhaltigere Fangmethoden zu ersetzen, schlicht nicht befolgt wurde, hat sich die Situation nicht verbessert«, sagt Jennifer Rehren. Das Problem ist komplexer, als es scheint.
Mit der hellen Haut und dem rotblonden langen Haar, das unter einem luftigen Tuch hervorscheint, fällt die Wissenschaftlerin auf am Strand. Auf der muslimisch geprägten Insel arbeiten nur wenige Frauen in der Wissenschaft — und schon gar keine auf Fischerbooten. Seit einem Jahr trifft Rehren die Fischer der Gegend hier jeden Tag. Sie zählt ihre Fänge und vermisst die Größe der Tiere akribisch, um die Bestände der Bucht von Chwaka zu erheben. Eine einfache, aber effiziente Methode.
Um sich mit den Männern verständigen zu können, hat Rehren schon in Bremen Kiswahili gelernt, die Amtssprache Tansanias, die auch in anderen Staaten Ostafrikas gesprochen wird. Das hat ihr geholfen, Vertrauen aufzubauen. Die Fischer begegnen ihr freundschaftlich, wie einem guten Kumpel. Bereitwillig zeigen sie ihr, was sie aus dem Meer gezogen haben. »Ohne ihre Unterstützung hätte ich meine Arbeit so nicht durchführen können.«
Er würde gerne anders fischen.

In der Schule von Marumbi ist es Mittag geworden. Es ist heiß und feucht, als die Männer sich zum Mittagsgebet zurückziehen. Danach präsentiert Jennifer Rehren ihnen ihre Ergebnisse. Sie unterscheiden sich in so manchen Aspekten von den zuvor erfassten Einschätzungen der lokalen Fischer: Da scheinen Fischarten bedroht zu sein, um die sich keiner gesorgt hatte. Andere Arten, bei denen die Fischer bislang fest davon ausgingen, sie seien überfischt, scheinen hingegen kaum gefährdet. Zudem hat Rehren herausgefunden, dass das Wissen der Fischer darüber, wie groß ein Fisch sein muss, bevor man ihn fangen darf, Lücken aufweist. Die Männer reagieren erstaunt, aber zustimmend.
Das interessanteste Ergebnis aber ist: Mit den als besonders umweltschonend geltenden Fangkörben und Reusen — den »traps« — wird in der Bucht mehr Fisch aus dem Wasser geholt als mit Schleppnetzen. »Das liegt schlicht daran, dass es zu viele Trap-Fischer gibt, dass eine selbstauferlegte Fangquote fehlt und dass die Fischgründe potenziell jedem offen stehen«, erklärt Rehren. Der Druck auf die marinen Ressourcen in der Bucht von Chwaka würde sich also sogar noch erhöhen, sollten die Schleppnetz-Fischer auf Reusen und Körbe umstellen.
Für Amour Hati Umbaya, einen großen Mann, der im eleganten traditionellen Gewand in der Schule erschienen ist, sind das schlechte Nachrichten. Mit anderen Männern aus Chwaka verdient er seinen Lebensunterhalt auf einem Schleppnetz-Boot. Ihm ist bewusst, dass die Fangmethode problematisch ist. Und er würde gerne anders fischen, auch, weil die Schleppnetzfischerei nicht ungefährlich ist.
Die Fischer müssen ständig hinabtauchen, um die Netze über die Riffe zu heben. Viele kommen mit geplatztem Trommelfell zurück an die Oberfläche. Sie können nicht mehr arbeiten, ihren Anteil am Fang erhalten sie trotzdem. Auch Hati Umbaya macht sich Sorgen. »Ich bin kein Forscher, aber ich habe akzeptiert, dass wir für unsere Zukunft Opfer bringen müssen.« Aber was tun, wenn nicht nur die Schleppnetze, sondern auch die traps die Fischgründe belasten? Wie solle er handeln? Wofür sich stark machen?
ÜBERFISCHT
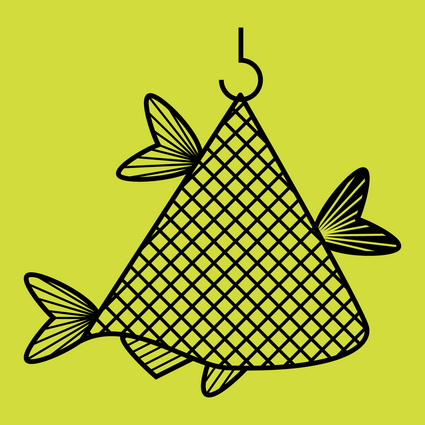
Auch global schrumpfen die Fischbestände seit Jahren bedrohlich. Dahinter steckt vor allem der industrielle Fischfang. Mit modernen Echoloten und Sonargeräten orten die Trawler Schwärme präzise, um sie mit kilometerlangen Treib- und Schleppnetzen abzufischen. Seit 1970 hat sich die Fangkapazität der Fischereiflotte weltweit verdoppelt. Die Bestände großer Speisefischarten wie Thunfisch und Heilbutt sind seit den 1950er Jahren um 90 Prozent gesunken. Die Welternährungsorganisation schätzt, dass 53 Prozent der befischten Arten bis an die Grenze genutzt, 32 Prozent sogar überfischt sind. Umweltorganisationen wie Greenpeace fordern die Einrichtung großflächiger Schutzgebiete, nachhaltige Quoten und umweltschonende Fangtechniken.
Nach Jennifer Rehrens Berechnungen müsste man beide Fangmethoden deutlich reduzieren, um die Bucht nachhaltiger zu befischen. Hunderte Fischer würden ihre Arbeit verlieren. Alternative Einkommensquellen haben sie nicht. »Der Weg in den boomenden Tourismussektor ist für die Einheimischen meist verstellt«, sagt der Ökonom Achim Schlüter vom ZMT. »Die Hotels bevorzugen Nicht-Muslime aus Tansania und Kenia, die für den Umgang mit Touristen besser ausgebildet sind.« Und so bleibt die schwierige Verständigung auf einen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen des Meeres die einzige Lösung. Mitunter fallen die Verteilungskämpfe der Fischer Sansibars heftig aus, auch zu Prügeleien kommt es. Mit seinen Doktoranden erforscht Achim Schlüter, warum sie nicht enger zusammenarbeiten.
Jennifer Rehren ist überzeugt, dass man die streitenden Fischer immer wieder zusammenbringen muss. Amour Hati Umbaya aus Chwaka etwa sagt, dass er Rehrens Workshop als großen Gewinn empfindet. »Jedes Mal, wenn wir uns treffen, bringt das etwas.« Die Vermittlungsbemühungen der Wissenschaftlerin hätten das Verhältnis der Fischer verbessert. Umbaya hofft, dass der Austausch weiter zunimmt. »Für die uns folgende Generation.«
Jedes der drei Dörfer hat an diesem Samstag in der Schule einen Aktionsplan entworfen. Auf großen Plakaten haben sie ihre Ideen skizziert, die sie einander nun vorne an der Tafel vorstellen. Die Stimmung ist konstruktiv. Die Männer hören einander aufmerksam zu, fragen nach, diskutieren. Gestritten wird nicht.
Die Fischer aus Marumbi schlagen vor, ein künstliches Riff zu erstellen, um die Biomasse in der Bucht zu erhöhen. Das habe schon einmal funktioniert, sagen sie. Schließlich verständigen sich die Anwesenden auf einen Vorschlag aus Uroa: die Einrichtung eines marinen Schutzgebietes, in dem jeglicher Fischfang tabu ist. Die Fische hätten so einen sicheren Rückzugsort, die Bestände könnten sich erholen.
»Auf dieser Idee können sie aufbauen«, findet Rehren, »aber erst müssen sie die Pläne in ihren Dörfern vorstellen, sie verteidigen, alle überzeugen.« Die Biologin plant, alle Vorschläge der Fischer zusammenzufassen. Sie möchte sie der zuständigen Behörde in Sansibar vorlegen. Und dem »Mwambao Coastal Community Network«, einer Nichtregierungsorganisation, die Fischer in den Tropen schon bei vergleichbaren Gemeinschaftsprojekten unterstützt hat.
Es ist die neunte Stunde nach Fischerzählung, als sich die Männer in Marumbi fürs erste voneinander verabschieden. Die Nachmittagssonne zeichnet Palmenschatten vor das Schulgebäude. Für Jennifer Rehren geht es zurück in ihre Unterkunft in Stone Town, dem alten Zentrum von Sansibar-Stadt. Bald wird sie nach Bremen fliegen. Wenn das Flugzeug über der Insel startet, wird ihr Blick auf die Strände, die Riffe und die Bucht von Chwaka fallen, an der die Fischer leben. Vielleicht haben sie heute einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft getan?












