Großer Dreesch, Weißwasser, Hellersdorf, Schwarze Pumpe. Neustadt, Lütten Klein, Grünau, Marzahn, Sandow, Lichtenhagen. Überall in der DDR schossen seit den 1960er Jahren die Hochhäuser wie Pilze aus dem Boden. Etwa zwei Millionen Wohnungen entstanden so bis 1990. Die aus vorgefertigten Betonplatten zusammengesetzten Wohnblöcke hatten bei vielen Menschen schnell ihren Namen weg: »Plattenbauten«. Ihre Bewohnerinnen und Bewohner hingegen nennen sie häufig noch heute, ein halbes Jahrhundert nach dem Bau, »Neubaugebiete«. Stadtgeografisch korrekt handelt es sich um Großwohnsiedlungen: einheitlich geplante, oft staatlich finanzierte Hochhausviertel mit 1.000 Wohnungen und mehr.
Industriell gefertigte Wohnblöcke wurden auch in Westdeutschland errichtet, doch im Osten prägten sie viele Städte. Und die Mentalität ihrer Bewohner. Im Plattenbau hat sich die DDR selbst verwirklicht
, sagt Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. In diesen traditionslosen Vierteln auf der grünen Wiese sollte die werktätige Klasse der DDR eine neue Form des Wohnens und des Lebens finden, ein sozialistisches Miteinander ausprägen.
Steffen Mau veröffentlichte 2019 eine persönlich geprägte Sozialgeschichte Ostdeutschlands, die zum Bestseller wurde: Er selbst wuchs in Lütten Klein auf, der namensgebenden Rostocker Plattenbausiedlung. Viele Leserinnen und Leser fühlten sich mitgenommen in das Viertel und zu seinen Menschen, die für Mau beispielhaft für die Veränderungen in Ostdeutschland stehen.

Knapp war vieles in der DDR, doch Wohnungen waren das knappste Gut überhaupt
, sagt Steffen Mau. Noch lange nach dem Krieg waren die Städte geprägt von Bombenlücken und maroden Altbauten. Die »Lösung der Wohnungsfrage« hatte für die Staatsführung deshalb oberste Priorität. Weil das Bauen mit traditionellen Mitteln zu langsam und zu teuer erschien, forcierte spätestens Erich Honecker ab 1972 das »Einheitsbausystem«: ein modulares System aus Großplatten, die zum Teil schon fertig verputzt und mit eingesetzten Fenstern und Türen die Fabrik verließen. Wie in einem überdimensionalen Lego-System konnten sie zu festgelegten Bautypen zusammengesetzt werden. Der bekannteste war die Wohnbauserie »WBS 70«, in der bis 1990 rund 650.000 Wohnungen entstanden. Die »Vollkomfortwohnungen« waren heiß begehrt — nicht nur bei jenen, die vorher in Altbauten mit Kohleofen und Toilette auf halber Treppe gewohnt hatten.
Plattenbaugebiete waren ein wichtiger Teil der Arbeitskräftemobilität
, sagt Steffen Mau. Die Wohnungen wurden über die Betriebe vergeben, und wenn irgendwo ein neues Kombinat aufmachte, baute man relativ schnell Wohnungen für 3.000 Werktätige und ihre Familien, die dann aus dem ganzen Land kamen.
Entsprechend homogen war die Bewohnerschaft der Plattenbauten: überwiegend gut ausgebildete 20- bis 40-Jährige mit Kindern, deren Lebensstil sich durch das Leben im Viertel weiter einander anglich. Vereinzelung war staatlich unerwünscht, der Rückzug ins Private nicht wirklich attraktiv angesichts der kleinen Wohnungen, die manche witzelnd »Arbeiterschließfächer« nannten.
Wer wollte, konnte sich beinahe rund um die Uhr in staatlich oder betrieblich organisierten Gruppen vergnügen: Es gab Betriebssportgruppen, »Subbotniks« für die gemeinsame Grünflächenpflege, Elternkollektive oder Partys im Trockenraum der Hausgemeinschaft. Die soziale Kontrolle war groß: Der Abschnittsbevollmächtigte, die Polizisten, die Lehrer wohnten ja auch alle dort
, erinnert sich Steffen Mau an seine Kindheit in Lütten Klein. Aber obwohl Aktivitäten außerhalb der Norm nicht erlaubt waren, haben wir uns unsere Freiräume genommen.
Wirken Plattenbauviertel heute auf Außenstehende anonym oder gar menschenfeindlich, war dort früher meist etwas los. Steffen Mau: In der DDR gab es fast keine Kriminalität, die Wohnblöcke waren selten abgeschlossen. Also waren wir schon im Vorschulalter im Viertel unabhängig unterwegs und klapperten nachmittags alle Freunde ab. Man kannte jeden auf der Straße und irgendwer war immer zu Hause.
Auch die besondere Struktur der Großwohnsiedlungen förderte das Zusammenleben. Aus der Sowjetunion hatten die DDR-Planer die Idee der sogenannten Mikrorajons übernommen: Größere Wohngebiete waren in kleinere Einheiten unterteilt, die sich um zentrale Infrastruktureinrichtungen gruppierten. So gingen alle Kinder eines Viertels in dieselbe »Kinderkombination« aus Krippe und Kindergarten und später in dieselbe Schule. In jedem Viertel gab es einen »Dienstleistungswürfel« mit Kaufhalle, Post, Friseur, Schuster und anderen Läden, der oft zum Treffpunkt wurde. Hierarchisch zusammengefasst, kamen dann für mehrere Wohngebiete zum Beispiel gemeinsame Schwimmhallen und weiterführende Schulen hinzu. Viele Neubaugebiete waren gut über den öffentlichen Nahverkehr erschlossen. Je weiter man in die Siedlung hineinging, desto fußläufiger wurde es. Steffen Mau sagt: Idealerweise waren diese Siedlungen Modellstädte, wie sie sich heute vielleicht die Grünen vorstellen: oft mit größeren Grünflächen und teilweise autofrei, dezentral mit viel Platz geplant und an jeder Ecke gab es einen Laden.
Das Ideal jedoch war teuer. Schon bald gab es große Unterschiede zwischen Vorzeigesiedlungen mit variantenreichen Wohnungen und guter Infrastruktur und anderen Vierteln, die billig aus dem Boden gestampft wurden. Es gab im Städtebau der DDR einen utopischen Moment
, sagt Steffen Mau. Doch als diese Utopie erkaltete, ist sie in ihr Gegenteil gekippt und wurde zu einer wenig lebenswerten, grauen Einheitskultur.
1988 zog er deshalb wie viele andere junge Leute aus dem Plattenbau in ein Altbauviertel, das mehr persönliche Freiräume versprach. Trotzdem würde ich nie auf Plattenbauten herabschauen.
Als Soziologe jedoch stellt Mau fest, dass das Prestige dieser Wohngebiete mit der Wende quasi über Nacht ins Bodenlose fiel. In Westdeutschland waren Großwohnsiedlungen häufig als unattraktive Entlastungsstädte geplant worden, in denen sich schon nach wenigen Jahren die sozialen Probleme häuften. Und bei der Wiedervereinigung übertrugen viele Menschen diesen Assoziationskontext auf die ostdeutschen Großwohnsiedlungen
. Galten deren Bewohnerinnen und Bewohner noch kurz zuvor als Arrivierte der werktätigen Klasse der DDR, fanden sie sich plötzlich als »Loser aus der Platte« am unteren Ende einer fiktiven Wohn-Prestige-Skala der vereinigten Bundesrepublik wieder.
Wohnblöcke am Rand sollten abgerissen, die Stadt sollte kompakter werden.
MATTHIAS BERNT
Weil die meisten Viertel für Arbeitskräfte der DDR-Kombinate gebaut worden waren, führte die Schließung der Betriebe dann tatsächlich zu einem raschen Niedergang. Wohnungen waren zudem keine Mangelware mehr: Durch subventionierte Neubauten und Altbausanierungen gab es plötzlich ein enormes Überangebot. Matthias Bernt vom Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS) sagt: Die ostdeutschen Großwohnsiedlungen verloren im Schnitt ein Drittel ihrer Bewohnerschaft, manche sogar die Hälfte.
Der Politikwissenschaftler untersucht seit gut 20 Jahren das Wohl und Wehe von Plattenbauvierteln. Es wird geschätzt, dass nur ein Viertel der abgewanderten Bewohner arbeitsmarktbedingt in die westlichen Bundesländer ging. Gut die Hälfte zog in Eigentumswohnungen, und der Verlust des restlichen Viertels ist durch demografische Wellen begründet.
Demografische Wellen, also das Auf und Ab der Geburten- und Sterbezahlen, beeinflussen ostdeutsche Großwohnsiedlungen besonders stark. Alle Neubauten wurden zur gleichen Zeit von Menschen bezogen, die im gleichen Alter waren und Kinder hatten: Flut. Heute, ein halbes Jahrhundert später, sind die Kinder ausgezogen und die Bewohnerinnen und Bewohner im Seniorenalter: Ebbe.
Natürlich konnten die Kommunalverwaltungen schon in den 1990er Jahren absehen, dass sehr viele Wohnungen leer bleiben würden
, sagt Matthias Bernt. Aber es war politisch nicht opportun, darüber zu reden.
Entvölkerte Plattenbausiedlungen passten nicht ins Bild blühender Landschaften. Erst 1998 setzte die Bundesregierung eine Expertenkommission ein, die schließlich einen wohnungswirtschaftlichen Strukturwandel in den neuen Ländern empfahl. Der 2001 gestartete »Stadtumbau Ost« ist im Wesentlichen ein Abriss-Programm: Mehr als 330.000 Wohnungen wurden bereits »rückgebaut«. Für Wohnungsunternehmen, die mindestens 15 Prozent Leerstand nachweisen konnten, übernahm der Staat die Abrisskosten und einen Teil der sogenannten Altschulden.


Die Idee war, Wohnblöcke am Rand abzureißen. Die Stadt sollte kompakter werden, nicht mehr benötigte Infrastruktur wie Schulen, Wasserleitungen, Straßenbahnschienen hätte eingespart werden können
, erläutert Matthias Bernt. Aber für Wohnungsunternehmen ohne Altschulden rechnete sich der Abriss nicht. In manchen Vierteln führte das zu schwierigen städtebaulichen Strukturen.
Einzelne Blöcke blieben stehen, dazwischen liegen nun weite, leere Brachen. Protest von Anwohnerinnen und Anwohnern habe es selten gegeben, sagt Bernt, der in den 2000er Jahren Befragungen in Weißwasser-Süd und Leipzig-Grünau durchführte. Den Menschen wurden Ersatzwohnungen angeboten. Und wer von einem WBS 70 in einen anderen umzog, konnte seine Möbel einfach an der gleichen Stelle wieder aufstellen.
Trotzdem sei es selbst für ihn als Besucher ein merkwürdiges Gefühl, heute wieder nach Weißwasser-Süd zu kommen: Viele Orte, die mit Erlebnissen und Erinnerungen verknüpft waren, sind spurlos verschwunden.
Plattenbau ist nicht gleich Plattenbau. Was schon zu DDR-Zeiten galt, gilt heute umso mehr. In Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt wie Berlin, Dresden oder Leipzig sind hochwertige und gut gelegene Großwohnsiedlungen sehr beliebt und es gibt kaum Leerstand
, sagt Matthias Bernt. Andernorts sind ganze Stadtviertel geprägt von vielfältigen sozialen Problemen.
Doch es kommt Bewegung in die Szenerie: Es ziehen wieder junge Menschen und Familien in die Plattenbauten. Seit 2015 sind es oft Geflüchtete, deren Asylantrag anerkannt wurde oder die eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Vor zehn Jahren lebten in Halle-Neustadt nur wenige Menschen ohne deutschen Pass. Heute sind es 35 Prozent, in manchen Wohngebieten sogar mehr
, sagt Matthias Bernt. Früher waren es vor allem Altbauviertel wie Berlin-Neukölln, die Einwanderinnen und Einwanderer anzogen. Dort gab es günstige Mieten, Läden mit internationalem Angebot und eine migrantische Community, die bei Behördengängen oder bei der Arbeitssuche weiterhalf. Doch Altbauten sind beliebt, die Mieten steigen. Deshalb werden nun Plattenbauviertel am Stadtrand zu Einwanderervierteln.
Den Großwohnsiedlungen fehlen öffentliche Räume, in denen sich alle gleichberechtigt begegnen können.
STEFANIE RÖßLER
Kann Diversität in der »Platte« funktionieren? Und was brauchen die Großwohnsiedlungen, um wieder zu einer lebendigen Heimat für neue und ältere Bewohnerinnen und Bewohner zu werden? Das untersucht der von Matthias Bernt koordinierte, interdisziplinäre Forschungsverbund »StadtumMig«, in dem das IRS mit dem Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung der Humboldt-Universität zu Berlin und weiteren Partnern zusammenarbeitet. Drei Großwohnsiedlungen in Halle, Schwerin und Cottbus nehmen die Forschenden bis April 2022 in den Blick.
Mit der Infrastruktur der Viertel beschäftigt sich die Landschaftsarchitektin Stefanie Rößler am IÖR. Sie kommt zu einem überraschenden Ergebnis: Ausgerechnet das, was viele Menschen als Vorteil von Plattenbausiedlungen sehen, kann zum Problem werden — viel Platz, viel Grün. Oft ist gar nicht klar, welche Freiflächen wirklich öffentlicher Raum sind und was man dort darf
, sagt Rößler. Auf vielen Grünflächen beispielsweise fühlt man sich beobachtet, weil sie so einsehbar sind. Freiwillig verbringt dort kaum jemand seine Zeit.
Den Großwohnsiedlungen seien die Orte verloren gegangen, an denen man sich früher zufällig getroffen habe: Läden, Eisdielen, Gaststätten, Freizeitangebote. Gerade in den drei untersuchten Vierteln gebe es zwar eine Vielzahl von Bildungs- und Freizeitprojekten, doch die seien oft nur für bestimmte Zielgruppen gedacht. Manche seien auch an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigeplant.

Am Beispiel von Nachbarschaftsgärten macht Stefanie Rößler die Herausforderungen deutlich. In Gärten könnten unterschiedlichste Gruppen zusammen gärtnern, grillen, die Natur genießen oder Tiere und Pflanzen kennenlernen. Bei Bewohnerbefragungen sind sie deshalb ein häufig genannter Wunsch. Aber gerade nach dem Rückbau von Gebäuden sind die Freiflächen in den Vierteln oft so groß, dass man mit einem Mähdrescher arbeiten könnte
, sagt Rößler. Ein Garten kann nur dann ein geschützter Raum sein, wenn er einen Rahmen hat.
Im praktischen Sinne könnte es also schon helfen, Hecken zu pflanzen. Im übertragenen Sinne braucht es Ansprechpersonen, die den Menschen zeigen, dass Aktivitäten an diesem Ort erlaubt und gewünscht sind.
Natürlich beseitigen solche Projekte nicht die zugrunde liegenden sozialen Probleme
, sagt Stefanie Rößler, aber sie könnten die Bewohnerinnen und Bewohner zusammenbringen und ihnen zeigen, dass auch ihre Lebensweise wertvoll für unsere Zukunft ist.
Nachhaltiger Konsum, sorgfältiger Umgang mit Lebensmitteln, Verzicht aufs Auto: Was viele Menschen praktizieren, um Geld zu sparen oder weil es in der DDR üblich war, könnte gesamtgesellschaftlich sogar zum Vorbild werden. Doch damit Menschen sich über solche Themen austauschen können, braucht es Treffpunkte. Was den Großwohnsiedlungen dringend fehlt, sind öffentliche Räume, in denen sich alle gleichberechtigt begegnen können
, fasst Stefanie Rößler ein erstes Ergebnis von »StadtumMig« zusammen. Nur wenn Menschen sich begegnen, können sie lernen, einander zu verstehen. Damit kann eine wichtige Voraussetzung für Integration geschaffen werden.
PLATTENSAMMLUNG
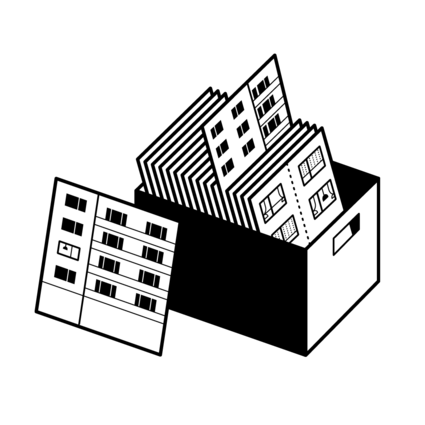
1990 warf die westdeutsche Architekturzeitschrift »Arch+« die Frage auf: Gab es in der DDR überhaupt Architekten? Ein klares Ja kann entgegnen, wer die Wissenschaftlichen Sammlungen des Leibniz-Instituts für Raumbezogene Sozialforschung besucht. Sie sind das wichtigste Spezialarchiv für die Bauund Planungsgeschichte des Arbeiter-und-Bauernstaats. Nicht nur Dokumente des Bundes der Architekten der DDR und rund 100 Vor- und Nachlässe ostdeutscher Baumeister gehören zum Bestand, sondern auch Unterlagen des Instituts für Städtebau und Architektur der Bauakademie der DDR. Die Zeichnungen, Pläne, Akten, Modelle, Fotos und Zeitzeugeninterviews geben vielfältige Einblicke hinter die Fassade der »Platte«. Das Archiv steht dem Fachpublikum offen, zahlreiche Objekte sind zudem digitalisiert und online zufinden.







