LEIBNIZ Herr Schröder, am Leibniz-Institut für Kristallzüchtung arbeiten Sie an Kristallen, aus denen Halbleiter gefertigt werden. Nun ist überall zu hören, dass uns die Chips fehlen. Was ist das Problem?
THOMAS SCHRÖDER Es stimmt, wir haben viel zu wenig Halbleiterchips, vor allem der neuesten Skalierungstechnologie. Denn egal, ob wir über Gesundheitstechnologien reden, über Laser, Smartphones oder Autos – überall stecken Chips drin. Unser Institut erforscht gemeinsam mit der Industrie, wie die Züchtung der für ihre Herstellung notwendigen Kristalle weiterentwickelt werden kann. Und hier liegt das Problem: Wir können in Europa alles, was mit Kristallzüchtung und Substraten zu tun hat. Was wir aber nicht können, ist die Verarbeitung der Kristalle zu hochwertigen Chips der neuesten Technologiegeneration.
Wenn Sie es nicht können, kann es doch bestimmt jemand anders?
SCHRÖDER Ja, na klar. Aber auch hier haben wir eine schwierige Situation. Die Zahl der Hersteller ist in letzter Zeit sehr übersichtlich geworden, vor allem was die europäischen Anbieter angeht.
Frau Flach, Sie als Leiterin des ifo Zentrums für Außenwirtschaft können an diesem Punkt bestimmt weiterhelfen. Warum gibt es nur noch wenige europäische Anbieter in diesem Bereich?
LISANDRA FLACH Das ist eine Folge der Globalisierung, genauer gesagt eine Folge der komparativen Kostenvorteile. Das heißt, wenn andere Länder etwas zu geringeren Alternativkosten herstellen können, verlagert man diesen Fertigungsschritt ins Ausland. So war es auch bei der Chip-Produktion.
Wohin ist sie abgewandert?
FLACH Taiwan ist in diesem Bereich absolut führend. Aber man muss beachten: Halbleiter ist nicht gleich Halbleiter. Allein ein neues Auto kann mehr als hundert verschiedene Chips enthalten, die sich in ihrer Strukturgröße und Funktion unterscheiden. Und dementsprechend ist die jeweilige Lieferkette sehr unterschiedlich und stark fragmentiert.
Aber wenn man diese winzigen Teile überall benötigt, warum baut sie dann nicht jeder?
SCHRÖDER So winzig Chips auch sein mögen, die Anfangskosten sind riesig. Für eine Fabrik müssen Sie erst einmal locker 20 Milliarden Dollar investieren. Und um eine solche Investition wieder reinzuholen, benötigen Sie einen weltweiten Vertrieb, sonst lohnt sich das nicht. An einem Chip verdienen Sie kaum etwas, es geht nur über die Masse. Und hier herrscht ein gnadenloser globaler Verdrängungswettbewerb. Als Ergebnis gibt es nur noch wenige große Anbieter: TSMC in Taiwan, Intel in den USA und Samsung in Südkorea.
In Europa ist niemand übriggeblieben?
SCHRÖDER Früher gab es noch Olivetti aus Italien oder Siemens bei uns in Deutschland. Doch man hat sich schon vor 20 Jahren gesagt: Wir steigen aus diesem Pfennig-geschäft aus! In Europa haben wir durchaus starke Anbieter, die auch hochfunktionalisierte Halbleiter auf etablierten Technologieknoten herstellen. Aber wann immer wir in den hochskalierten Bereich von zwei oder drei Nanometern kommen und höchste Logik- und Speicherdichte benötigen, müssen wir in Taiwan, Korea oder in Amerika anrufen. Und wenn die Chinesen vorher angerufen und gleich zehnmal mehr bestellt haben, schauen wir in die Röhre.

Nun haben Sie beide gesagt, dass immer mehr Chips benötigt werden. Aber es ist ja sicher nicht sinnvoll, in allen Bereichen und Größen aufholen zu wollen.
FLACH Wie gesagt, allein für ein Auto wäre eine gesamte Industrie notwendig, um die unterschiedlichen Halbleiter zu produzieren. Das geht natürlich nicht. Stattdessen müssen wir die Forschung an neuen Halbleitern fördern und auch andere Technologiefelder ausfindig machen, die in Zukunft erheblich zur Wertschöpfungskette beitragen. Damit wir klar vor Augen haben: In Bereichen wie der Künstlichen Intelligenz sollten wir dabei sein!
Herr Schröder, Sie haben ein Strategieforum ins Leben gerufen, das sich mit technologischer Souveränität beschäftigt. Was steckt hinter diesem Konzept?
SCHRÖDER Zunächst handelt es sich um eine Positionierung zwischen Autarkie und Abhängigkeit: Einerseits wollen wir im Bereich der wichtigen Technologien, etwa bei Künstlicher Intelligenz oder Klimatechnologien, nicht abhängig sein von bestimmten Lieferketten oder einzelnen Ländern. Sonst hängen wir immer am seidenen Faden, wenn der Bedarf an einem Produkt wie den Halbleitern steigt. Andererseits wäre das Ziel völliger Autarkie schlichter Unfug in einer international vernetzten Wissenschafts- und Wirtschaftswelt.
FLACH Ja, wenn ich diesen Begriff schon höre: Autarkie! Ein Rückzug aus der Globalisierung würde in Deutschland enormen Wohlstand zerstören. Wir wären deutlich ärmer, wenn wir uns aus der internationalen Arbeitsteilung zurückziehen und so auf unsere komparativen Vorteile verzichten würden.
SCHRÖDER Deshalb positionieren wir uns mit der Technologie-Souveränität zwischen beiden Polen. Das BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung; Anm. d. Red.) verwendet in seinen Papieren gerne den Begriff Augenhöhe. Aber was soll das in diesem Bereich bedeuten?! Es geht um Autonomie. Wir wollen in den Schlüsseltechnologien selbst entscheiden können. Das ist für mich Technologie-Souveränität.
Welchen Beitrag wollen Sie mit dem Leibniz-Strategieforum leisten?
SCHRÖDER Technologie-Souveränität bedeutet auch Vernetzung. Wir bringen rund 20 Leibniz-Institute aus den Naturwissenschaften mit Instituten aus anderen Bereichen, beispielsweise den Wirtschaftswissenschaften, zusammen. So wollen wir einen interdisziplinären und holistischen Ansatz verfolgen, um zur technologischen Souveränität Deutschlands und der Europäischen Union beizutragen und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Hier wollen wir uns als Leibniz-Gemeinschaft einbringen und ganz gezielt machen wir das in den Schlüsseltechnologien, die das BMBF definiert hat. Zwei Beispiele sind zukünftige Kommunikationstechnologien und die Wasserstoffwirtschaft.
EIN NETZWERK FÜR MORGEN
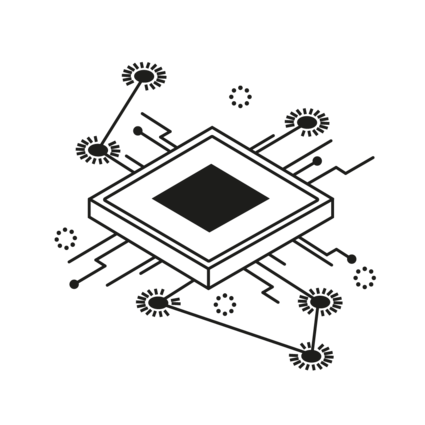
Nicht einmal zehn Prozent — so groß oder besser klein ist der europäische Anteil am internationalen Chipmarkt. Die Folgen spürt gegenwärtig insbesondere die Autoindustrie: Immer wieder stehen Bänder still, weil die vor allem aus Asien importierten Chips nicht zu bekommen sind. Wie sich Deutschland und die Europäische Union aus solchen Abhängigkeiten befreien und zentrale Schlüsseltechnologien weiterentwickeln können, darüber beraten Forschende im neu gegründeten Leibniz-Strategieforum »Technologische Souveränität«. Die rund 20 beteiligten Leibniz-Institute bilden dabei einen wesentlichen Teil der Wertschöpfungskette ab, von der Grundlagen- über die angewandte Forschung bis hin zu Prototypen und Kleinserien. Zur besseren Vernetzung werden derzeit sechs thematische Cluster eingerichtet, etwa zu Gesundheitstechnologien, Künstlicher Intelligenz oder Materialien für die Digitalisierung.
Frau Flach, Herr Schröder möchte also, dass Europa gemeinsam technologisch souverän wird. Das klingt schön, aber ist meist nicht ganz einfach.
FLACH In der Tat, einfach wird das nicht. In der Europäischen Union zu kooperieren, ist sicherlich nicht der einzige, aber aus meiner Sicht der einzig richtige Weg. Hierbei ist die Marktgröße der EU sehr wichtig, denn selbst ein Industrieland wie Deutschland kann alleine keine Standards setzen, um auch geopolitisch eine wichtige Rolle zu spielen. Darauf aufbauend ist es dann aber ratsam, weitergehende Kooperationen aufzubauen.
Wie sieht es mit Kooperationen in der Wissenschaft aus, Herr Schröder?
SCHRÖDER Hier haben wir schon viel erreicht. Wir haben einen EU-Forschungsraum, in dem europäische Forscherinnen und Forscher gemeinsam Anträge stellen und an Projekten arbeiten. Und ganz ehrlich: Nichts macht mehr Spaß, als sich in einem internationalen Umfeld austauschen und arbeiten zu können. Und es stimmt: Europa ist für die Normierung wie für die Zertifizierung sehr wichtig.
Also alles bestens? Das kann ich nicht glauben.
SCHRÖDER Nein, natürlich gibt es Probleme. Im Bereich 6G müssen wir dringend vorne dabei sein, denken Sie etwa an die Konsequenzen einer zu langsamen Datenübertragung beim autonomen Fahren. Aber ausgerechnet in einem so wichtigen Bereich sehe ich bislang keine gesamteuropäischen Anstrengungen. Es ist ein so weites Feld, dass man sehr gut sagen könnte: Spanien übernimmt diesen Part, Griechenland einen anderen, Italien wieder einen anderen und so weiter.
Und warum gelingt das nicht? Das Rennen um 5G haben wir krachend verloren, da müsste man doch die entsprechenden Lehren ziehen.
SCHRÖDER Tja, es versucht mal wieder jeder, das Maximale für sein Land aus den EU-Töpfen herauszuholen. Zudem ist die Aufgabe sehr komplex.
FLACH Ich begrüße natürlich auch die europäischen Bemühungen. Aber wie gesagt: Wir dürfen nicht den Rest der Welt aus den Augen verlieren. Auch eine europäische Initiative sollte nicht zu Protektionismus führen. Sonst wird aus einer europäischen Chance schnell ein Risiko für die globalen Lieferketten.

Protektionismus ist allerdings spätestens seit Donald Trumps Parole »America First« en vogue. Steht das nicht der Vernetzung entgegen, die Sie anstreben, Herr Schröder?
SCHRÖDER Natürlich können wir uns nicht völlig davon freimachen, wenn die US-Regierung sagt: Wer mit Firmen oder Universitäten aus dem Iran oder China zusammenarbeitet, wird sanktioniert. Dann sind auch wir in einer schwierigen Situation und gegebenenfalls gezwungen, solche Kooperationen zu beenden. Insgesamt tut sich aktuell ein Spannungsfeld auf zwischen Wissenschaftlern, die versuchen, ein globales Netz der Zusammenarbeit zu knüpfen, sowie der Wirtschaft und Politik, die stärker auf nationalen Protektionismus setzen. Das erschwert es uns ungemein.
Können Sie sich denn vorstellen, mit China zusammenzuarbeiten?
SCHRÖDER Als mögliche Lösung plädiere ich dafür, zumindest die Grundlagenforschung, in der wir von den Anwendungen noch 15 bis 20 Jahre entfernt sind, aus diesem Spannungsfeld herauszunehmen. So könnten wir mit jungen Forschenden aus der Volksrepublik China zusammenarbeiten. Bei konkreter Anwendungsforschung wird eine Zusammenarbeit zunehmend schwieriger. Hier wahren wir die Interessen unserer europäischen Forschungspartner. Aber auch bei ehemaligen chinesischen Partnern in Wissenschaft und Forschung beobachte ich eine zunehmende Zurückhaltung.
Frau Flach, wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit einem Staat wie China?
FLACH Sie ist schwierig, aber extrem wichtig. Wir müssen mit China einen konstruktiven, aber kritischen Dialog über Zusammenarbeit und Wettbewerb führen. Denn warum streben wir denn Technologie-Souveränität an? Hauptsächlich wegen der angespannten geo- und sicherheitspolitischen Lage im Hinblick auf Staaten wie China. Da muss man ganz klare Grenzen ziehen und schauen, in welchen Feldern eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Gleichzeitig haben wir den Austausch zwischen China und Europa genauer untersucht und stellen fest: So einseitig ist die Abhängigkeit gar nicht. Auch China ist auf Europa angewiesen. Ein rigides Decoupling wäre für alle fatal. Europa braucht dennoch dringend eine langfristige Strategie, um technologisch souverän zu werden.
Haben wir die denn nicht?
FLACH Die EU hat dieses Jahr eine Strategie veröffentlicht, die ist aber sehr vage und statisch. Aktuell handeln wir sehr reaktiv. So bauen wir jetzt ein Werk für Halbleiter, die wir aber schon längst benötigen. Wenn dieses Werk fertig ist, brauchen wir vielleicht schon wieder ganz andere Chips. Wir müssen weiter in die Zukunft schauen, eine dynamische Sichtweise entwickeln, damit wir von Anfang an dabei sind. Dafür benötigen wir bessere Forschung und Entwicklung.
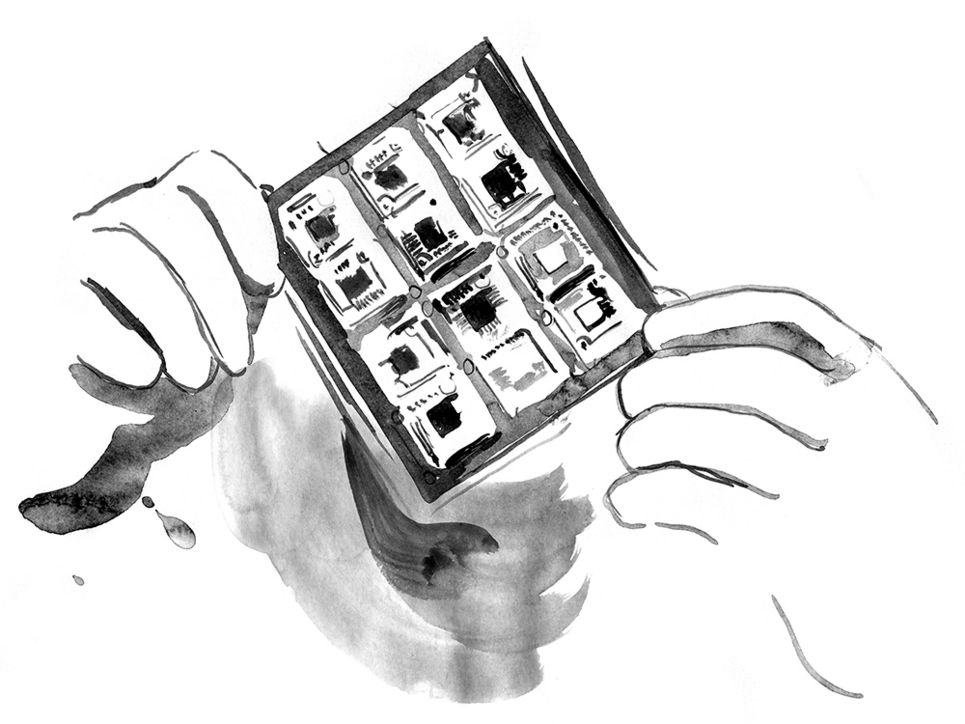
Wenn man sich mit Forschenden in Deutschland unterhält, wird deutlich, dass wir in der Grundlagenforschung eigentlich sehr gut aufgestellt sind. Um im Bild des Autos zu bleiben: Jetzt müssten wir also die PS aus der Forschung auf die Straße bringen?
SCHRÖDER Ja, durchaus. Es gibt auch schon Fortschritte: Wir arbeiten beispielsweise eng mit etablierten Firmen zusammen, die uns Forschungsaufträge geben, weil auch sie es sich nicht mehr leisten können, sämtliche Geräte und Labore selbst aufzubauen. Unsere Ergebnisse fließen dann direkt in Produktionsprozesse ein. Und das läuft auch in anderen Forschungsfeldern gar nicht so schlecht, wie man in der Impfstoffforschung zuletzt am Beispiel der mRNA-Impfstoffe sehen konnte. Dort haben 20, 30 Jahre Grundlagenforschung jetzt bei Biontech zum Durchbruch geführt.
Welche Rolle spielt hierbei die Politik?
FLACH Sie müsste die richtigen Rahmenbedingungen setzen — und hier gibt es viel zu tun. Wir brauchen eine leistungsfähige Kommunikationsinfrastruktur, eine Verkehrsinfrastruktur, attraktive steuerliche Bedingungen. Und zu guter Letzt muss man Bürokratie abbauen. All das sind Hindernisse für die Entwicklung neuer Technologien, die es zu überwinden gilt.
SCHRÖDER Wir brauchen auch eine neue Start-up-Kultur. Mehr Mut, etwas zu wagen, neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Oft ist das Problem, dass das wissenschaftliche Projektende nicht der Produktstart ist. An diesem Übergang scheitern viele. Bei uns am Institut versuchen wir deshalb, den Ausgründungsprozess besser zu begleiten, etwa indem wir eine Inkubationsperiode von bis zu fünf Jahren anbieten, um das Produkt und vor allem die Produktion zu verfeinern. Denn wie bei den Halbleitern gilt: Mit einem einzigen Chip kann man nichts verdienen, obwohl wir sie überall brauchen.



