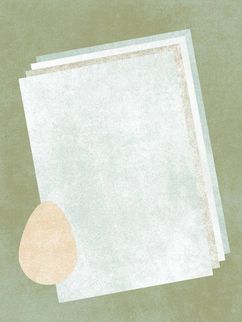LEIBNIZ Die für Wettbewerb zuständigen EU- Minister haben im Juni beschlossen, bis 2020 alle öffentlich finanzierten Wissenschaftspublikationen unter Open Access-Lizenz erscheinen zu lassen. Ist das der Durchbruch für den freien Zugang zu wissenschaftlicher Literatur?
KLAUS TOCHTERMANN Zurzeit erscheinen circa 14 Prozent der wissenschaftlichen Publikationen im Open Access; man müsste also innerhalb von vier Jahren die übrigen 86 Prozent umstellen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, aber trotzdem richtig, weil ohne solche Ziele keine Bewegung ins System kommt.
Das Ziel ist keineswegs verbindlich …
… aber so bleibt Druck auf dem System.
Veröffentlicht wird dort, wo der sogenannte Impact-Faktor am höchsten ist, die zentrale Maßeinheit für wissenschaftliche Exzellenz in vielen Disziplinen. Den höchsten Impact-Faktor weisen bislang etablierte Journale der kommerziellen Verlage auf. Bleiben Open Access-Magazine hier nicht zwangsläufig chancenlos?
Tatsächlich sind der Impact-Faktor und Maßzahlen für Zitationshäufigkeiten wie der »h-index« für Open Access absolut kontraproduktiv. Daher ist eine der Forderungen der »Amsterdamer Erklärung« zu Open Science, wegzukommen von der sehr singulären Messung wissenschaftlicher Leistung durch Impact-Faktoren. Stattdessen sollte der Impact weiter gefasst und die gesellschaftliche Wirkung miteinbezogen werden.
Wie wollen Sie die messen?
Die Indikatoren dafür muss die Wissenschaft entwickeln, etwa der Wissenschaftsrat oder der Rat für Informationsinfrastrukturen. Aus der Leibniz-Gemeinschaft heraus haben wir mit einer Gesprächsreihe zur »Indikatorik für die Digitalisierung der Wissenschaft« einen kleinen Anstoß gegeben und hoffen, dass das Thema jetzt aufgegriffen wird. Ein anderes Beispiel ist die bürgerbeteiligte Forschung, oft Citizen Science genannt. Hier steht Wissenschaft in direktem Bezug zu gesellschaftlichen Belangen. Es ist höchste Zeit, konkreter zu werden.
Open Access wäre finanzierbar, aber es müssen alle mitmachen.
KLAUS TOCHTERMANN
Wird die Marktmacht der großen kommerziellen Verlage fortbestehen?
Nicht unbedingt. Im Wissenschaftssystem müssen politische Regeln aufgestellt werden, die festlegen, in welchem Ausmaß etwa Fördermittel an die Bedingung gekoppelt werden, im Open Access zu publizieren. Großbritannien und die Niederlande machen das mit sehr strikten Regeln vor. Es braucht aber auch Anreize für die einzelnen Forschenden.
So wie den neuen Publikationsfonds der Leibniz-Gemeinschaft?
Zum Beispiel. Dieser unterstützt Autoren dadurch, dass er ihnen die Publikationsgebühren abnimmt, die viele Open Access-Zeitschriften erheben, um ihre Kosten für die Bereitstellung der Infrastruktur zu decken.
Das verlagert die Kosten für wissenschaftliche Literatur von der Leserseite auf die Autorenseite. Der Zugang zur Literatur ist frei, aber dafür entstehen neue finanzielle Hürden, die vor allem für junge Wissenschaftler ein Problem sein dürften.
Der Markt für wissenschaftliche Literatur, deren Lizenzen bei Verlagen liegen, umfasst in Deutschland etwa 300 Millionen Euro, die öffentlich finanzierte Bibliotheken investieren müssen, damit ihre Nutzer die Journale für ihre Forschungsarbeiten verwenden können. Die durchschnittliche Publikationsgebühr für einen Artikel im Open Access liegt in Deutschland bei circa 1.250 Euro. Sie könnten also sehr viele Open Access-Publikationen finanzieren, wenn es die Lizenzen nicht mehr gäbe. Problematisch ist jedoch der Wandel vom einen in das andere System. Aktuell haben wir beide Modelle, was teuer ist. Open Access wäre finanzierbar, aber es müssen alle mitmachen.
Was heißt das konkret für die ZBW?
Wenn ich den Publikationsetat der ZBW von etwa 4 Millionen Euro pro Jahr einspare, könnte ich mit dem Geld etlichen Nachwuchswissenschaftlern die Publikationsgebühren bezahlen. Das ist aber noch nicht möglich, weil wir die wirtschaftswissenschaftliche Community mit Fachzeitschriften und Monografien versorgen müssen — und dafür werden meist noch Lizenzen fällig. Wenn die gesamten Wirtschaftswissenschaften auf Open Access umsteigen würden, wäre das kein Problem.
Sie brauchen also mehr Geld, um in der Übergangszeit beides leisten zu können?
Nein, wir benötigen eine breite Debatte in der Wissenschaft. Open Access muss eine flächendeckende Bewegung werden. Europa hat hier eine Schlüsselrolle. Denn in Asien funktioniert quasi nichts ohne Impact-Faktoren. Von dort wird Open Access keinen Rückenwind bekommen. In Amerika ist es ähnlich.
OPEN ACCESS

Mit Open Access hat jeder freien Zugang zu wissenschaftlicher Literatur. Aktuell verbreiten kommerzielle Verlage diese immer noch gegen zum Teil immense Abo- oder Lizenzgebühren, obwohl die ihnen zugrundeliegende Forschung oft aus öffentlichen Geldern finanziert wurde. Dafür bieten die Fachjournale mit dem sogenannten Impact-Faktor, der die Zitierhäufigkeit und damit die Bedeutung einer Publikation anzeigt, einen wesentlichen Maßstab für wissenschaftliche Exzellenz. Open Access läuft heute im Wesentlichen in zwei Modellen ab: Auf dem »Goldenen Weg« erscheint eine Publikation sofort in einem Open Access-Journal. Auf dem »Grünen Weg« wird ein Artikel parallel oder zeitversetzt in einem kommerziellen Journal und auf sogenannten Repositorien veröffentlicht, auf Dokumentenservern wie »Leibniz Open« (www.leibnizopen.de).
Ist Open Access überhaupt die richtige Antwort auf die Digitalisierung, nachdem wir in der Vergangenheit viele Debatten um Fälschungen und Plagiate erlebt haben?
Das hat nichts mit Open Access zu tun. Wir hatten es schon im gedruckten Bereich mit Plagiaten oder unseriösen Zeitschriften zu tun. Es stimmt aber, wir müssen in der Wissenschaft viel deutlicher machen, dass Open Access nicht automatisch zum Qualitätsverlust führt. Denn wir können hier dieselben Qualitätskriterien anwenden wie bei lizenzierten Veröffentlichungen.
So ganz hat es Open Access jedoch noch nicht geschafft, den Ruf der Zweitklassigkeit abzuschütteln.
Das bisherige Finanzierungsmodell über Publikationsgebühren birgt die Gefahr, dass ein Verlag möglichst wenig von den Einnahmen für teure Qualitätssicherung ausgeben will. Es gibt aber mit dem »Directory of Open Access Journals« bereits ein durch die Wissenschaft selbst organisiertesVerzeichnis, in dem alle seriösen Open Access-Zeitschriften gelistet sind. Wichtig ist auch ein prominent besetztes Herausgeber-Gremium, dessen Mitglieder einen Ruf zu verlieren haben und deshalb auch auf Qualitätsstandards achten.
Open Access spielt eine Rolle in den Wirtschafts-, den Natur- und Lebenswissenschaften. Wie ist das bei den Geisteswissenschaften?
In den Geisteswissenschaften haben wir ein ganz anderes Publikationsverhalten. Dort ist die große Monografie, die gedruckt in einem renommierten Verlag erscheint, der Goldstandard. Zahlenmäßig sind das weniger Veröffentlichungen, die unter geringerem Zeitdruck entstehen, als in anderen Disziplinen, die Fachaufsätze veröffentlichen. Grundsätzlich spricht aber auch hier nichts gegen Open Access, ebenso wenig in den Technikwissenschaften. Entscheidend ist: Die Debatte um Open Access muss endlich raus aus dem Zirkel der Bibliothekare, der Wissenschaftspolitik und der Forschungsförderer und rein in die Kreise der Forschenden, damit wir diskutieren können, wie und wo Open Access-Ansätze aus ihrer Sicht sinnvoll sind.
Wie wird sich die Rolle der Bibliotheken durch Open Access ändern?
Der Prozess der Digitalisierung ist nicht mehr aufzuhalten und findet unabhängig von Open Access statt. Wir haben an der ZBW 4,2 Millionen gedruckte Werke. 2014 sind davon 330.000 ausgeliehen worden, 2015 waren es nur noch 260.000. Umgekehrt haben unsere Nutzer 2010 800.000 digitale Dokumente aus unserem Angebot herunter geladen. Ende 2015 waren es mehr als 5 Millionen Dokumente. Daher ist unser Konzept für die Zukunft »content to the user«; wir bringen die Inhalte zu den Nutzern und zwingen sie nicht wie früher zu den Inhalten zu kommen — also in die Bibliothek. Dafür müssen wir das Nutzerverhalten der Studenten und Wissenschaftler genau kennen und wissen, wo sie auf unsere Inhalte zugreifen wollen, bei Facebook, Mendeley oder als weiterführende Literatur zur Wikipedia-Recherche. Für den überwiegenden Teil der wissenschaftlichen Bibliotheken bedeutet Open Access aber vor allem: weg von der reinen Informationsversorgung, hin zum Publikationsmanagement, etwa über die Bereitstellung von Repositorien, Bibliografie-Management oder Autorenberatung.
Steht den Traditions-Verlagen das große Sterben bevor?
Nein, wenn wir auf Open Access umsteigen, könnten die Verlage in einer sinnvollen Arbeitsteilung vor allem Dienstleistungen anbieten, die Bibliotheken nicht so gut können: etwa das Hosten und Verbreiten von Journalen. Ihre Einnahmen würden sie dann nicht mehr über Lizenzen erzielen, sondern über Services wie Publikationsgebühren oder auch Mehrwert-Dienstleistungen, die etwa auf Text- und Data-Mining basieren.
Wie lange wird der Umstieg auf Open Access dauern?
Ich glaube nicht, dass ich seine Vollendung während meiner verbleibenden Berufszeit von 17 Jahren noch erleben werde. Doch der große Trend zur weitestgehenden Öffnung der Forschungs- und Publikationsprozesse in der Wissenschaft ist klar abzusehen. In der Physik erscheinen beispielsweise nicht nur Ergebnis-Publikationen, sondern es werden schon Ideen und Zwischenergebnisse auf dem Open Access-Repositorium »arXiv« veröffentlicht und diskutiert. Diesem Modell werden andere Disziplinen folgen. Die Wissenschaft der Zukunft wird anders, offener arbeiten.