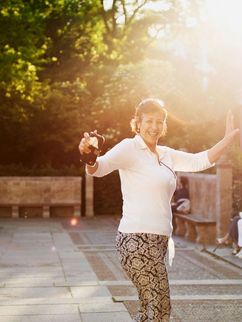Meine Urgroßmutter war die stärkste Frau, die ich je kannte. Antaram Abrahamian, spätere Boghossian, war das unangefochtene Oberhaupt unserer Familie. Sie arbeitete unermüdlich, schlief wenig und kümmerte sich liebevoll um ihre beiden Töchter, deren Kinder und sogar um ihre Urenkel. Nie beschwerte sie sich über ihre Verpflichtungen und hatte den feinsten Sinn für Humor. Wie mein Vater nannte ich sie »Medzmama«, Armenisch für Großmutter. Aber nicht nur uns, den Verwandten, war es vorbehalten, sie so zu nennen. Auch Nachbarn, Freunde und Bekannte, ob jung oder alt — alle riefen sie »Medz«. Die Große.
Als Kind habe ich mich immer gefragt, warum. Später nahm ich an, sie spürten und respektierten wohl schlicht ihre Autorität, bewunderten ihre Geduld, vor allem aber ihre Widerstandskraft. Schließlich hatte sie sich in einer grausamen Welt, die sie schon früh zur Waise gemacht hatte, stets geweigert, aufzugeben. Stattdessen war Antaram — »die Unvergängliche« — ihrem Namen treu geblieben und hatte die Stärke gefunden, ihr Leben neu zu beginnen.
Sie stammte aus Çengiler, einem Dorf in der Nähe der Stadt Bursa im Westen Anatoliens. Die große Mehrheit seiner etwa 5.000 Einwohner waren Armenier, die von ihren Olivenhainen lebten oder Handwerke wie das Schmieden von Hufeisen, Zinn und Gold oder die Ledergerberei betrieben. Çengiler war außerdem eines der Zentren der Seidenraupenzucht und der Spinnerei, der wichtigsten Industrien in und um Bursa. Hunderte Bewohner bedienten die mehr als 500 dampfbetriebenen Spinnräder in den Werkhallen.
1913 gründeten die Menschen des Dorfs eine Kooperative. Wie eine Nachbarschaftsbank förderte sie kleine Geschäfte und Handwerksbetriebe. Ihre Waren lockten tausende Kunden, der Handel blühte auf. 1914 exportierte Çengiler mehr als 2.000 Kilogramm Rohseide nach Lyon, Marseille, Mailand und London. Es waren ruhmreiche Zeiten für die Dorfbewohner. Wichtige Mitglieder der armenischen Gemeinschaft kamen sie besuchen, Intellektuelle, Schriftsteller, Priester und Musiker.

Antaram wurde 1901 in Çengiler geboren. Als erste und einzige Tochter folgte sie auf drei ältere Brüder. Ein vierter Bruder sollte bald hinzukommen. Später würde Antaram sich wünschen, es wäre eine Schwester gewesen.
Im August 1914 entriss die Generalmobilmachung der osmanischen Armee für den Ersten Weltkrieg dem Dorf die Männer. Doch noch bis in den Mai des folgenden Jahres deutete nichts darauf hin, was kommen würde. Dann begannen die Hausdurchsuchungen und die Verhaftungen. Offiziell sollten sie die Bevölkerung dazu drängen, den Behörden ihre Waffen zu übergeben. Ab Juli 1915 schließlich machte die Nachricht von Vertreibungen die Runde.
Am 4. August 1915 umstellten 2.000 Soldaten und Gendarmen das Dorf. Die Deportation begann. Noch Jahrzehnte später erzählte meine Urgroßmutter, wie ihre Familie auf das Deportationsgesetz des osmanischen Parlaments, den »tehcir«, reagierte. Während alle hastig die wichtigsten Habseligkeiten zusammenpackten, war Antarams Mutter Maryam plötzlich verschwunden. Aus dem Keller klang das Splittern von Glas. Unten fanden sie Maryam, die wie rasend Gläser voll Marmelade auf dem Boden zerwarf. Antarams Vater wurde wütend und schrie, sie sei wohl verrückt geworden. Maryam hielt für einen Moment inne. Mit ruhiger Stimme sagte sie: »Glaubst du wirklich, wir werden unser Haus je wiedersehen, hier einen nächsten Winter verbringen, um das zu essen? Wir werden nichts zurücklassen, nichts für die, die für unser Unglück und unseren Verlust verantwortlich sind.«
Sie sollte Recht behalten. Nach einem kurzen Wortwechsel mit den Dorfältesten zwangen die Gendarmen die etwa 1.200 Familien aus ihren Häusern. Die amerikanischen Missionare, die seit den 1860er Jahren in der Region aktiv waren, berichteten später, dass sich einige zunächst weigerten, das Dorf zu verlassen. Doch man trieb sie auf eine lange und ungewisse Reise. Nur etwa 100 Männer hielten die Osmanen im Dorf zurück. Sie zwangen sie, die Besitztümer der Armenier in die Kirche zu schleppen, wo die Soldaten und Gendarmen alles unter sich aufteilten. Im Anschluss plünderten sie den Rest des Dorfes, brannten alles nieder und ermordeten die Gefangenen.
EIN DUNKLES KAPITEL

Es begann am 24. April 1915 mit einer Verhaftungs- und Deportationswelle im damaligen Konstantinopel. »Aghet« — die Tat, die ins Innere dringt und zerstört — nennen die Armenier den Mord an ihrem Volk. Zwischen 800.000 und 1,5 Millionen Männer, Frauen und Kinder fielen den Strapazen der Vertreibung zum Opfer oder wurden von Soldaten der osmanischen Armee ermordet. Das Deutsche Reich, einer ihrer Verbündeten, schaute tatenlos zu, einige Generäle beteiligten sich an der Planung und Durchführung des Genozids. Die Türkei hadert bis heute mit ihrer Verantwortung für die Taten, auch, weil die Zeit eng mit dem Gründungsmythos des Landes verbunden ist. Wie die Geschehnisse bezeichnet werden, ist ein Politikum. Als der Deutsche Bundestag in seiner »Armenien-Resolution« zum 100. Jahrestag der Vorgänge offiziell von Völkermord sprach, führte das zu schweren Spannungen mit der Türkei.
Çengiler war nun verlassen, sein quirliges Leben ausgelöscht, seine Zukunft zerstört. Selbst die Vergangenheit raubte man dem Dorf: Ein zentraler Teil der osmanischen Unterdrückungspolitik bestand darin, das Andenken an die Armenier und ihre Kultur auszulöschen, etwa durch das Verbot, in der Öffentlichkeit Armenisch zu sprechen. Tausenden Städten, Dörfern, Siedlungen und Plätzen gab man neue Namen. Auch Antarams Geburtsort verschwand von der Karte. Çengiler hieß nun Sugören.
Kaum eine Stunde vom Dorf entfernt, trennten die Soldaten auch die verbliebenen Männer von den Frauen und exekutierten sie am Ufer eines Flusses. Antaram verlor ihren Vater und ihren ältesten Bruder. Rasch verkleidete die Mutter den Jüngsten als Mädchen. Antarams andere beiden Brüder waren bereits vor Jahren nach Bulgarien und Istanbul gegangen, wo sie nun die Ungewissheit über das Schicksal ihrer Familie quälte.
So begannen die drei »Frauen« der Abrahamian-Familie einen langen Marsch, der erst im Osten Syriens enden sollte, im Flüchtlingslager Deir ez-Zor. Ein Überlebender berichtete später, dass sich rund 11.000 Menschen aus der Umgebung Bursas mit ihnen auf den Weg machten. Die drei beteten, dass sie beisammenbleiben konnten. Doch schon bald merkten die Soldaten, dass mit Antarams kleiner »Schwester« etwas nicht stimmte und begannen, an »ihrer« Kleidung zu zerren. Unter dem Kopftuch kam das kurze Haar eines siebenjährigen Jungen zum Vorschein. Trotz der Wehklagen von Mutter und Schwester rissen die Soldaten ihn aus der Gruppe und töteten ihn vor ihren Augen. Bald darauf starb auch Maryam an den Folgen der Erschöpfung, des Hungers und wohl auch des Verlusts.
Antaram blieb alleine im Trek zurück, als einziges Familienmitglied erreichte sie das Flüchtlingscamp. Wie meine Urgroßmutter dort als kaum 16-jährige Waise lebte und überlebte, wissen wir nicht. Sie sprach fast nie davon, wie viele Armenier ihrer Generation. Es gibt verschiedene Szenarien und womöglich sind sie alle in Teilen wahr: Sie könnte in einem Waisenhaus gelebt haben, auch ältere Mädchen fanden dort Zuflucht, wenn sie sich nützlich machten. Es ist auch denkbar, dass sie bei anderen Bewohnern des Dorfes blieb, der einzigen Verbindung zu ihrem früheren Leben. Waren sie ihre Beschützer? Vielleicht zogen sie im Lager gemeinsam von Unterschlupf zu Unterschlupf, blieben eng beinander. Vielleicht schuftete Antaram in einer der osmanischen Fabriken, die im syrischen Homs und Hama errichtet wurden, und musste dort die Kriege ihrer Vertreiber unterstützen.
Wie alle im Lager muss sie unter Krankheiten, Hunger und Elend gelitten haben. Zeitzeugen berichten zwar auch von Barmherzigkeit gegenüber den Kindern. Meist sprechen sie aber von Arbeitsdiensten, Zwangskonvertierung, ständiger Gewalt und sexuellem Missbrauch. Bis zum Ende des Krieges harrte Antaram in Deir ez-Zor aus. Als der Waffenstillstand 1918 ihre Zeit in der Wüste beendete, machte sie sich wie viele andere Überlebende auf den Weg ins irakische Basra.


Sicher ist: Das frischverheiratete Paar befand sich unter denen, die die Briten aus Basra in eine neue Heimat bringen wollten. »Sie setzten uns in ein Boot und brachten uns nach Istanbul«, erzählte meine Urgroßmutter immer wieder, mit Dankbarkeit in der Stimme. Sie überlebte die Deportation, den Genozid und die Flüchtlingslager, durchlitt Unterernährung, Misshandlung und sexuelle Belästigung. Die Hoffnung auf ein neues Zuhause hielt sie am Leben. Weil die Armenier des nach dem Krieg britisch besetzten Istanbuls mit Ausnahme weniger prominenter Intellektueller von den Massakern und Deportationen verschont geblieben waren, traf sie dort ihren Bruder Sahak.
Die Reise zu ihm muss Wochen gedauert haben. Obschon sie über das warme Mittelmeer segelten, waren meine Urgroßeltern häufig hungrig, erschöpft und froren. Die Furcht, die Verzweiflung und die Angst der vergangenen vier Jahre aber waren verschwunden. Sahak nahm seine Schwester und ihren Mann in seinem Haus in İcadiye auf, einer großen armenischen Gemeinde auf der asiatischen Seite der Stadt. Er machte sie zu Teilhabern seiner Schlachterei. So konnten sie sich niederlassen und eine Familie gründen. Antaram sah ihre Töchter heiraten und ihre Enkel und Urenkel aufwachsen. Die gesamte Familie lebte in der Nachbarschaft. Meine Eltern wohnen noch heute in dem Haus, in das sie 1977 nach ihrer Hochzeit zogen, nur einen Block von der Schlachterei der Urgroßeltern entfernt.
Antaram entfernte sich in ihren über 80 Lebensjahren keinen Zentimeter mehr von ihrem Haus. Ihr Heimatdorf Çengiler, das kaum zwei Stunden entfernt lag, sah sie nie wieder. Weder besuchte sie ihren zweiten Bruder und seine Familie im Ausland, noch begleitete sie ihren Ehemann, als der nach Jahren der Sehnsucht armenische Verwandte in der Sowjetunion besuchte. Sie weigerte sich sogar, in den europäischen Teil der Stadt zu fahren, weil sie keinen Fuß auf ein Boot setzen wollte, das den Bosporus überfährt.
In all den Jahren machte sie nichts so glücklich, wie die tiefverwurzelten Obstbäume in ihrem Garten, deren Früchte sie Glas um Glas für den Winter einkochte.

NAZAN MAKSUDYAN
erforscht am Leibniz-Zentrum Moderner Orient das Schicksal von Waisenkindern im Osmanischen Reich des 19. und 20. Jahrhunderts. Immer wieder ist der Genozid an den Armeniern dabei ein Thema, denn die meisten Überlebenden waren Kinder. Auch Maksudyan selbst ist Armenierin, ihre Urgroßmutter war eine der Waisen. »Eine Überlebende in der Familie gehabt zu haben, ist für mich als Historikerin von großem Wert. Antarams Geschichte ist ein Paradebeispiel für das kollektive Gedächtnis einer Familie, die das Erlebte von Generation zu Generation weitergibt. Ihre Töchter haben sie meinem Vater erzählt, er erzählte sie mir. Seine Erinnerungen habe ich mit den Berichten anderer Zeitzeugen und weiteren Quellen abgeglichen. Trotzdem ist die Geschichte meiner Urgroßmutter weit davon entfernt, vollständig zu sein. Sie schwieg über viele Details.«