I. Die Haut der Meere
Für einen Außenstehenden mag es absurd erscheinen, was Manuela van Pinxteren auf ihren Forschungsreisen auf offenem Meer tut: Fensterputzen.
Im Sommer 2015 fuhr sie auf dem Forschungsschiff »Meteor« von Rostock über die Ostsee bis vor die Küste Gotlands. Vor der schwedischen Insel kletterte sie in ein Schlauchboot und schaukelte ein paar hundert Meter gegen den Wellengang an, um schließlich eine Glasplatte ins Wasser zu tauchen, sie langsam wieder herauszuheben und mit einem handelsüblichen Scheibenwischer abzuziehen.
Die Forscherin vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS) in Leipzig ist einer hauchdünnen Schicht auf der Spur. Sie bedeckt alle Ozeane der Welt und bildet die wohl größte Oberfläche überhaupt. Mit jeder Probe versucht van Pinxteren die Haut der Meere zu durchdringen: Woraus besteht sie? Und warum ist sie überhaupt da?
Der auch »sea-surface microlayer« genannte Oberflächenfilm ist schon länger bekannt, doch erst jetzt rückt er weltweit in den Fokus der Forschung. In dem Programm »SOLAS« (Surface Ocean Lower Atmosphere Study) haben sich Wissenschaftler aus 31 Nationen gemeinsam der gelartigen Schicht gewidmet. Sie bildet ein Portal zwischen Luft und Wasser, zwischen zwei Sphären, die sich in ständigem Austausch befinden.
»Die Ozeane und die Atmosphäre beeinflussen sich wechselseitig«, sagt der Chemiker Hartmut Herrmann vom TROPOS, »wir können beides nicht verstehen, wenn wir sie getrennt voneinander betrachten.« Ein Beispiel, das den Film für die Forschung so interessant macht, ist der Klimawandel: Wenn sich die Atmosphäre erwärmt, tun das zeitverzögert auch die Meere — und sie schicken eine Antwort zurück.
Auch van Pinxteren war Teil des SOLAS-Projekts. Die Proben aus der südschwedischen Ostsee hat sie eingefroren und in Plastikflaschen nach Leipzig geschickt. Dort hat sie das von der Scheibe gewischte Wasser in seine Bestandteile zerlegt, um sie mit den Inhaltsstoffen des Wassers unter der Oberfläche und der Luft unmittelbar darüber abzugleichen. Ihr Ergebnis: Die Haut der Meere setzt sich vollkommen anders zusammen. In ihr spielen sich chemische Reaktionen ab, die so noch nie in der Natur beobachtet wurden.
Der gerade einmal einen Millimeter dicke Oberflächenfilm gedeiht besonders in nährstoffreichen Wassern, bei ruhiger See und wärmendem Sonnenschein. Er setzt sich aus abgestorbenen Organismen, Stoffwechselprodukten der Meeresbewohner, Zucker und verschiedenen Säuren zusammen, aber auch aus Staub und Plastikteilchen. Außerdem ist er ein Sammelbecken für winzige, in Luftblasen eingeschlossene Partikel. Bei stürmischer See werden sie mit der Gischt in die Luft geschleudert und zerplatzen. Dort binden die auch Aerosole genannten Partikel Wasser und steigen in die Höhe. Die Haut der Meere bildet Wolken.
Das hat Auswirkungen aufs Klima: Erwärmen sich Luft und Wasser, bilden sich auch mehr Wolken, die die Sonne abschirmen. Es wird kühler, als hätte jemand ein Thermostat herunter gedreht. »Theoretisch wäre es denkbar, dass eine Art Regelkreis dahinter steckt«, sagt Hartmut Herrmann vom TROPOS. »Das ist aber nur eine erste These.«
Eine ähnliche Vermutung formulierten Wissenschaftler bereits in den späten 1980er Jahren. Die CLAW-Hypothese geht davon aus, dass speziell Algen das Wetter beeinflussen. Wird es ihnen zu warm, sondern sie die Schwefelverbindung Dimethylsulfid ab, die in der Luft über der Meeresoberfläche Keime für Wolken bildet. Kühlen diese das Wetter ab, fahren die Algen die Schwefelproduktion wieder herunter. Weniger Wolken entstehen.
Vor Gotland, wo Wasserwirbel besonders nährstoffhaltiges Wasser aus der Tiefe an die Oberfläche spülen, wollte van Pinxteren nun herausfinden, ob neben Dimethylsulfid auch andere Verbindungen eine ähnliche Wirkung haben. Im Labor konnte sie nachweisen, dass sich im Oberflächenfilm etwa das Spurengas Glyoxal bildet. Wie stark es in die Wolkenbildung eingreift, untersuchen die Forscherin und ihre Kollegen auf einer Forschungsstation auf den Kapverden. Auch vor dem Inselstaat im Zentralatlantik nehmen sie mit Wischer und Scheibe Wasserproben. Zugleich fangen sie auf der Spitze eines Berges Aerosolpartikel mit einem Wolkensammler ein und vergleichen die Zusammensetzung der Proben. Erste Ergebnisse bestätigen: Die Sphären stehen in Verbindung.

II. Gas aus der Tiefe
Wenn Oliver Schmale Gasblasen sammeln will, lässt er einen kleinwagenschweren Roboter zu Wasser, der über ein Kabel mit einem Schiff verbunden ist. Am Grund angelangt stülpt das »ROV« (Remote Operating Vehicle) mit grobmotorischen Armen ein Glasgefäß über einen Krater, aus dem es sprudelt wie aus einer Champagnerflasche. Jetzt kommt der »Bubble Catcher« zum Zug: Er fängt die Blasen, um die es Schmale geht. Sie umschließen Methan, ein Klimagas, das 25 Mal wirksamer ist als Kohlendioxid. Unter anderem entsteht es, wenn spezielle Mikroorganismen fressen, was an organischem Material auf den Grund rieselt, etwa die Ausscheidungen oder sterblichen Überreste von Meerestieren.
Noch macht das Klimagas aus dem Meer nur einen Bruchteil des Methans aus, das jedes Jahr in die Atmosphäre gelangt. Der Großteil wird von Feuchtgebieten wie Mooren freigesetzt, entstammt der Viehhaltung und entweicht bei der Förderung und dem Transport von Erdgas. Doch das könnte sich bald ändern: Die Erderwärmung könnte große Mengen Methan aus dem Meeresgrund freisetzen.
Im vergangenen September fuhr Oliver Schmale mit dem Forschungsschiff »Poseidon« über die Nordsee bis etwa 200 Kilometer vor die Küste Schottlands. Den Punkt hatte der Geologe vom Warnemünder Leibniz-Institut für Ostseeforschung bewusst gewählt. Seit einer Probebohrung an einem unterirdischen Gasfeld im Jahr 1990 steigt hier aus einem 50 Meter breiten Krater in großen Mengen Methan auf. Aber: In der Atmosphäre über dem Meer konnten die Forscher nur einen Teil des Klimagases nachweisen.
Das frei gewordene Methan, so weiß man, ist ein gefundenes Fressen für Bakterien. Für manche von ihnen ist das kohlenstoffhaltige Gas die Hauptnahrungsquelle. Sie wandeln es in das weniger klimaschädliche CO2 um. Mit Hilfe des Bubble Catchers konnte Schmale zeigen, wie die Bakterien dabei vorgehen: Sie heften sich an die Haut der Gasblasen und steigen mit ihnen in Richtung Oberfläche auf. Wenn die Blasen platzen, so vermuten die Forscher, gelangen die Bakterien wieder in die Wassersäule. Dort fressen sie das freigewordene Methan.
Das Gasfeld in der Nordsee liegt in nicht einmal 100 Metern Wassertiefe. Um alles Methan aufzufuttern, müsste den Bakterien also eigentlich die Zeit fehlen. Eine mögliche Erklärung dafür, warum sie es dennoch schaffen, lieferten Wissenschaftler der Universität Kiel: Sie beobachteten einen Wasserwirbel, der die Gasblasen in einer Spirale die Wassersäule hinauf transportierte. »Der Weg ist damit deutlich länger, mehr Methan wird aus den Blasen freigesetzt«, sagt Oliver Schmale. »Und auch die Bakterien haben mehr Zeit anzugreifen.«
Dennoch sollte man sich in Zukunft nicht all zu sehr auf die winzigen Methanfresser verlassen. Durch die Erderwärmung könnte sich das aggressive Klimagas gerade im Flachwasser freisetzen, etwa in den überfluteten Permafrost- oder Schelfgebieten Sibiriens. Die Mikroorganismen könnten ihre Mahlzeit in diesem Fall nicht beenden. Große Mengen Methan würden in die Luft entweichen. Und den Klimawandel weiter ankurbeln.
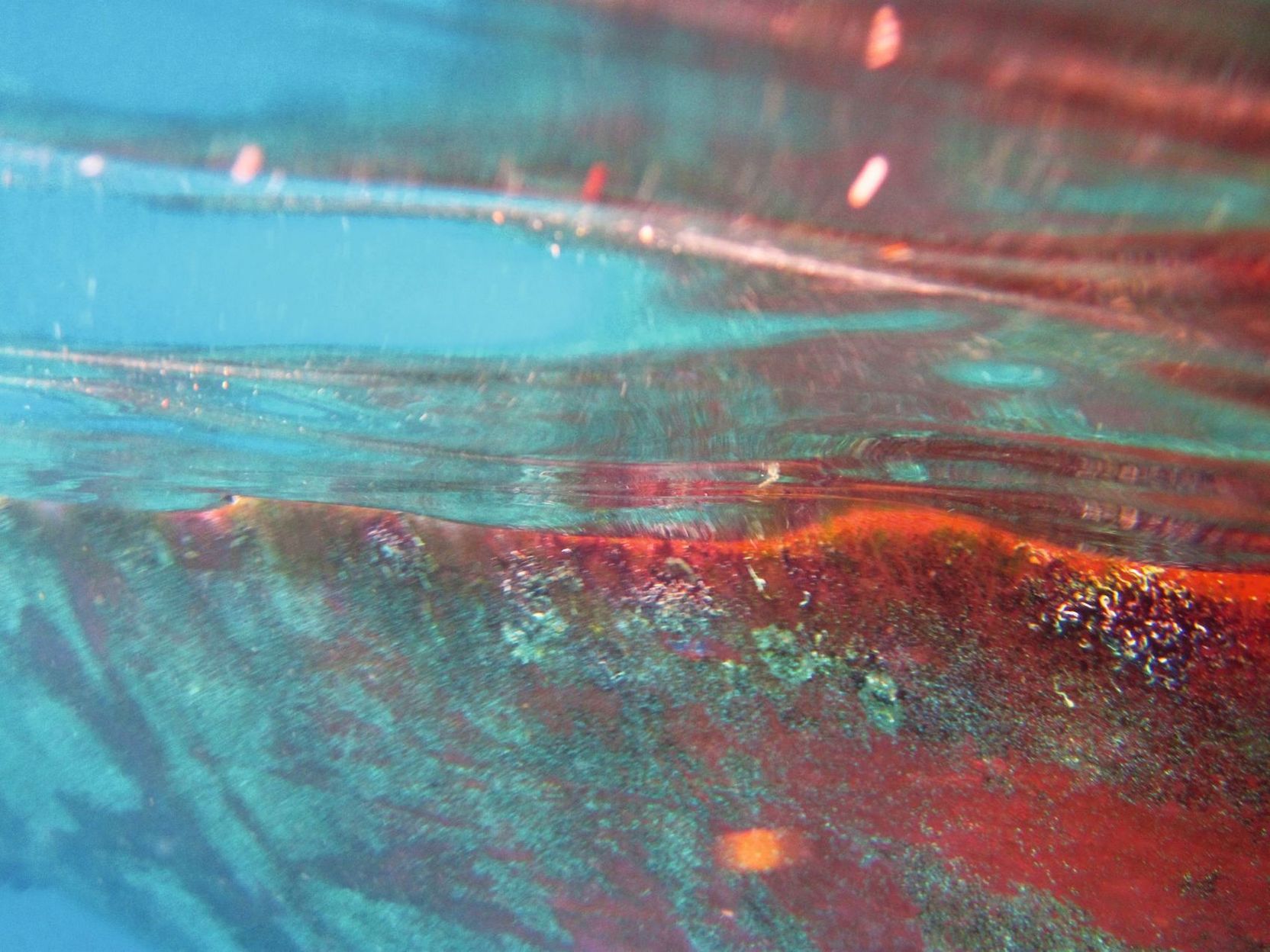
III. Marine Gedankenspiele
Sie wollen Kohlendioxid aus der Atmosphäre durch Pipelines in die Tiefsee leiten. Träumen von gigantischen Pumpen, die kaltes Wasser von dort unten in die Höhe drängen, um der Erwärmung der Meere entgegenzuwirken. Von Schiffsflotten, die Meerwasser versprühen, um Wolken zu erschaffen und so die Sonne abzuschatten.
Die Meere mögen im Zuge des Klimawandels an ihre Grenzen stoßen: Korallen, Muscheln und Schnecken sterben, Fische wie die Makrele wandern in kältere Gewässer. Dennoch betrachten einige sie nicht nur als Opfer des Klimawandels. Sondern als Teil einer Lösung.
Schon heute diskutieren Forscher unter dem Schlagwort »Climate Engineering« Großexperimente im Meer, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Der Ökonom Wilfried Rickels vom Kieler Institut für Weltwirtschaft unterzieht sie einem Realitätscheck. Welche Ideen lassen sich wirklich umsetzen? Unter welchen Bedingungen? Und zu welchem Preis?
Da ist die Idee mit der Düngung. Eisensulfat soll in das Südliche Eismeer gestreut werden, um das Wachstum von Algen anzuregen. Sie binden CO2 und transportieren es in die Tiefsee, wenn sie sterben. Neuere Studien zweifeln diesen positiven Klimaeffekt allerdings an, auch weil mit der Zahl der Algen zugleich die der Tiere zunähme, die sich von ihnen ernähren. »Die Eisendüngung kann der Atmosphäre nur einen kleinen Teil des Klimagases entziehen«, sagt Rickels. Zugleich würde sich das marine Ökosystem stark verändern.
Eine weitere Option, die Rickels prüft, ist der Kalk. Er ist ein Gegenspieler des Kohlendioxids, macht die Meere basischer und wirkt so der Versauerung der Ozeane entgegen. In den biologischen Kreislauf greift er anders als der Eisendünger kaum ein. »Diese Maßnahme ist fast perfekt«, sagt Rickels, »aber eben nur fast.« Der Haken: Für einen spürbaren Klimaeffekt bräuchte es Unmengen an Kalk, um eine Tonne CO2 zu neutralisieren, wären zwei bis vier Tonnen nötig. »Wir müssten massiv anfangen, Gebirge abzubauen«, sagt Rickels. Dennoch könne die Methode helfen, lokal begrenzt. Etwa im Great Barrier Reef, wo schon heute die Korallenstöcke ausbleichen. Die Kalkspritze könnte ihr Absterben bremsen. Aufhalten kann sie es nicht.
So hätten praktisch alle Ansätze ihre Schwachpunkte, sagt Rickels. »Und sie sind extrem riskant, weil wir mit ihnen gravierend in die ökologischen Kreisläufe eingreifen.« Oft sei es Abwägungssache, ob man einen Versuch unternehmen solle oder nicht. Was ist das drängendere Problem? Die Versauerung der Meere — oder ihre Erwärmung? »Aber wenn wir deshalb nichts von derlei Ansätzen wissen wollen, brauchen wir nicht mehr über das Zwei-Grad-Ziel zu reden.«
In gewissem Sinne könne man aber trotz Erderwärmung, Versauerung und Überfischung optimistisch bleiben. Das Leben sei anpassungsfähig, man müsse nur in größeren Zeitskalen denken. »Auf lange Sicht werden wir das Erdsystem wahrscheinlich nicht kaputt kriegen«, sagt Rickels. »Es werden ein paar Arten verschwinden, eventuell auch wir — aber dann auch wieder neue entstehen.«



