»Am Anfang war der Wasserstoff«, sagt Else Starkenburg. Ein fast biblischer Satz. Nicht mit dem Wort, wie es im Neuen Testament heißt, fing für die Astrophysikerin also alles an, sondern mit jenem farblosen Gas, dem chemischen Element »H«, dem die Erfinder des Periodensystems die Ordnungszahl »1« zuwiesen.
Else Starkenburgs schmales, lichtdurchflutetes Büro im Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam-Babelsberg hat absolut nichts Sakrales. Funktionale Möbel, ein Schreibtisch, darauf ein Telefon, ein PC und ein Laptop. Und dennoch befasst sich Starkenburg hier mit fundamentalen Fragen. Fragen, die philosophischer kaum sein könnten und zu denen dieser biblische Satz vom Anfang gut passt. Sie will verstehen, wie alles begann. Damals, vor 13,8 Milliarden Jahren, nach dem Urknall, der in der modernen Kosmologie den Beginn des Universums markiert. Dazu sucht sie nach den allerersten Sternen.
»Am meisten fasziniert mich, dass sie so weit weg sind«, sagt die holländische Forscherin. »Wir können nicht einfach zu den Sternen fliegen und eine Probe nehmen. Aber trotzdem versuchen wir, ihre Entstehung zu rekonstruieren — anhand dessen, was von ihnen übrig ist.«
Else Starkenburg ist 33 Jahre alt, Potsdam ihre dritte Station. Bevor sie 2014 hierher kam, hat sie im niederländischen Groningen studiert und forschte zweieinhalb Jahre in Kanada. Ihr Forschungsgegenstand ist die Milchstraße, die Heimatgalaxie unseres Sonnensystems. Was wir bisweilen als hell leuchtendes Band am Nachthimmel sehen können, ist von außen betrachtet eine flache Scheibe, die aus Milliarden von Sternen besteht.
»Man muss sich die Erde wie eine von sehr vielen Rosinen in einem flachen Pfannkuchen vorstellen«, sagt Starkenburg. »Weil wir mittendrin sitzen, sehen wir nicht den Pfannkuchen, sondern nur die Rosinen um uns herum.« Das sei kein Nachteil, denn so könne man die Milchstraße sehr ausführlich beobachten und verstehen, wie Galaxien ganz allgemein entstehen.

Wenn Else Starkenburg erklären möchte, worin ihre Arbeit besteht, zieht sie sich eine schwarze Outdoorjacke über die bunte Bluse, marschiert über das weitläufige Gelände des Instituts und bittet in das Medien- und Kommunikationszentrum. In einem kleinen Vorführraum im Keller hat ein Kollege auch schon zwei Virtual-Reality-Brillen bereitgelegt. »Ein Stern behält seinen chemischen Fingerabdruck sein ganzes Leben lang«, erklärt Starkenburg. Und: Je weniger Masse er habe, desto länger bleibe er bestehen. Für das Forscherteam ist das ein glücklicher Umstand. »Wir können alte Sterne nutzen, um die Vergangenheit zu untersuchen.« Im Grunde sei es eine Art galaktische Archäologie — sie selbst Milchstraßenarchäologin.
Das Alter der Sterne bestimmt Starkenburg anhand ihrer chemischen Zusammensetzung. Um die Kniffe dieses Ansatzes zu verstehen, ist aber erstmal eine Einführung in die Kosmologie nötig. Starkenburg zieht sich eine der Brillen übers Haar und lehnt sich in ihrem Stuhl zurück. Dann startet sie die Simulation »Sterne«.
Ein dreidimensionales samt-schwarzes Universum tut sich auf. Darin wirbeln orangefarbene und violette Lichtpunkte wie fliegende Funken um einen sich um die eigene Achse drehenden Kern. »Im Universum funktioniert alles nach den Gesetzen der Gravitation«, erklärt Starkenburg, während in der Simulation immer mehr Lichtpunkte um den Kern kreisen. »Ich stelle mir das immer vor wie beim Geld. Wer schon viel hat, dem fällt es leichter, neues zu akkumulieren. So ist das auch mit der Materie im All.«
Entscheidend sei das Gleichgewicht, die Balance zwischen der Anziehung, die vom Kern ausgeht und dem Gasdruck, der durch die Kernfusion entsteht, die einen Stern am Leben hält. »Solange es besteht, strahlt der Stern.« Erst wenn nicht mehr ausreichend Elemente für die Fusion vorhanden sind, gerät das Gleichgewicht aus der Balance. Der Stern zerfällt. Am Ende kommt es zu einer Supernova: Eine Explosion schleudert die neu entstandenen schwereren chemischen Verbindungen ins Universum. Dann beginnt alles von vorne, nur dass dieses Mal auch die neuen, komplexeren Elemente in der nächsten Gaswolke enthalten sind. Eine neue Sternengeneration ist geboren.
»Wir gehen davon aus, dass die allerersten Sterne aus nur drei gasförmigen Elementen bestanden«, sagt Starkenburg, »Wasserstoff, Helium und ein wenig Lithium.« Einen solchen Stern habe bislang noch kein Forscher entdeckt.
»Sterne der ersten Generation sind für uns deshalb so etwas wie der Heilige Gral.« Was jedoch gefunden wurde, sind etwa zwei Dutzend Sterne, bei denen Wissenschaftler davon ausgehen, dass sie zu den frühen Sternengenerationen gehören — nicht zur ersten zwar, aber möglicherweise zur zweiten oder dritten. Starkenburg hofft, dass es unter den Trilliarden von Sternen im Universum noch weitere gibt. »Sie sind schwer zu finden«, sagt sie. Aber genau das sei ihr Ziel.
»Es hat etwas Magisches«, sagt Starkenburg und nimmt die Brille ab. »Letztlich hat alles Leben mit den ersten drei Elementen seinen Anfang genommen.« Sie hält inne.
»Im Grunde besteht das gesamte Universum aus Sternenstaub, also auch wir Menschen.« Es fasziniere sie, dass ihre Arbeit sie immer wieder an die Grenzen der Wissenschaft führe, sagt Starkenburg. Wie war das Universum nach dem Urknall beschaffen? Wie haben sich darin Sterne und Galaxien gebildet? Oder: Woraus besteht die »dunkle Materie«, ohne die im Standardmodell der Kosmologie die Bewegung der sichtbaren Materie nicht erklärt werden kann?
»Ich mag diese großen Fragen«, sagt Starkenburg, »weil sie einen aus dem Klein-Klein der täglichen Arbeit erheben. Es macht Spaß, von Zeit zu Zeit darüber nachzudenken und sich immer wieder daran zu erinnern, wie winzig wir Menschen im Vergleich zum Universum sind.« Als Wissenschaftlerin sei sie es dabei gewohnt, auf viele Fragen keine Antwort zu haben. Dieses Nichtwissen gelte es auszuhalten. »Ich kann verstehen, dass Menschen angesichts dieser Fragen Antworten im Spirituellen suchen«, sagt sie. Ihr selbst sei das noch nicht passiert. »Ich halte es lieber so: Niemand hat genug Erkenntnisse, um genau zu wissen, wie alles begann — auch nicht die Religion.«
STERNENBAND
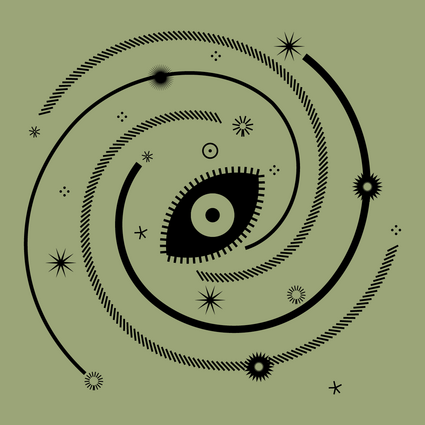
Alle rund 6.000 Sterne, die wir mit bloßem Auge am Nachthimmel ausmachen können, sind Teil von ihr. Auch unser Sonnensystem zählt dazu und mit ihm die Erde. Insgesamt bilden 100 bis 300 Milliarden Sterne und riesige Mengen interstellarer Materie die Milchstraße, die es auf 400 Milliarden Sonnenmassen und einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren bringt. Sie hat die Form einer Scheibe, in deren Zentrum ein Balken aus besonders vielen Sternen sitzt, von dessen Enden sich spiralförmige Arme wegdrehen. Ihren Namen verdankt die Milchstraße ihrer Erscheinung: Als helles Band zieht sie sich in dunklen Nächten über das Firmament. Schätzungen gehen davon aus, dass sich das Milchstraßensystem vor 13,6 Milliarden Jahren bildete. »Kurz« nach Entstehen des Universums, das sich wahrscheinlich aus mehr als einer Billion Galaxien zusammensetzt.
Starkenburg geht mehrmals im Jahr mit verschiedenen Teleskopen auf die Suche nach den ersten Sternen. Sie stehen nicht in Potsdam, sondern zum Beispiel in der chilenischen Atacama-Wüste und auf der Kanareninsel La Palma.
»Dort ist es viel dunkler als in Berlin«, sagt Starkenburg. Die Atmosphäre sei ruhiger und erzeuge so weniger Lufttrübungen, die die Ergebnisse verfälschen.
Das chilenische Teleskop ist so kompliziert, dass es nur von den Experten vor Ort bedient wird. Im Observatorium auf La Palma dagegen müsse man noch alles selbst machen, sagt Starkenburg. Wenn die Sonne untergeht, bereiten die Forscher das Teleskop vor und stellen sicher, dass alle Geräte funktionieren, erst dann öffnen sie die Kuppel. Flüssiger Stickstoff kühlt die Instrumente, ein Spektrograf zerlegt das Licht in seine Farben, sodass exakte Aufnahmen der Sterne entstehen, die für die Potsdamer besonders interessant sind.
Konkret sind das für Starkenburg besonders alte Sterne, die nur wenige schwere Elemente besitzen. Sichtbar wird die Zusammensetzung der chemischen Elemente in einer Spektralfotografie. Darauf sind sie als dunkle Striche zu erkennen. Kalzium lasse sich in dieser Darstellung besonders leicht ablesen, erklärt Starkenburg. Deshalb guckt sie sich immer zuerst die Kalziumkonzentration eines Sterns an.
Zurück in ihrem Büro klappt sie den Laptop auf und ruft einen der etwas mehr als 1.000 Sterne auf, die sie und ihr Team im Moment untersuchen. Seine Darstellungsform auf Starkenburgs Laptop könnte unscheinbarer nicht sein: eine weiße Linie auf schwarzem Grund.
Die Forscherin ist trotzdem begeistert. Sie deutet auf einen Ausschlag des Graphen in der linken unteren Ecke des Bildschirms. »Hier ist die Kalziumlinie viel kleiner als die Wasserstofflinie. Das bedeutet, dass dieser Stern sehr alt sein könnte.« Vielleicht gehört er tatsächlich zur zweiten Generation? Es wäre ein Durchbruch.
Erst wenn Starkenburg und ihre Kollegen mehrere dieser frühen Sterne gefunden haben, kann die qualitative Analyse beginnen. »Dann können wir womöglich bestimmte Muster erkennen, die uns verraten, wie sie entstanden sind.« Es sei immer wieder spannend, all diese Sterne zu betrachten, sagt Else Starkenburg dann und schaut vom Bildschirm auf. »Zu wissen: Du bist gerade der erste Mensch, der das erblickt.«



