Indem wir meditieren, bringen wir unser Gehirn ins Gleichgewicht und steigern unsere Leistungsfähigkeit. Dass das selbst bei Meditationsanfängern der Fall ist, haben Forscher des Leibniz-Instituts für Neurobiologie (LIN) in Magdeburg kürzlich im Rahmen einer Studie gezeigt. Mit Hilfe einer komplexen Messreihe konnten sie nachweisen, dass sich das Gehirn Meditierender einem Zustand optimaler Informationsverarbeitung annähert. Mit Stefan Dürschmid, Matthias Deliano und Bankim Subhash Chander haben wir uns über neuronale Zustände und den Achtsamkeitstrend unterhalten – und sie gefragt, warum Meditation ein spannender Forschungsgegenstand ist.
LEIBNIZ Meditation und Achtsamkeit liegen seit Jahren im Trend und es gibt immer mehr Menschen, die mit diesen Methoden experimentieren. Doch es gibt auch viele Skeptiker, die das alles für reine Esoterik halten. Was möchten Sie diesen Menschen entgegnen?
BANKIM SUBHASH CHANDER Da in Studien immer wieder gezeigt wurde, dass Achtsamkeit und Meditation wirksame Mittel zur Stressreduktion und zur Behandlung verschiedener Erkrankungen sind, würde ich ihnen entgegen: Es funktioniert. Skeptiker bezweifeln das vermutlich, weil sie nicht verstehen, wie es zu diesen Wirkungen kommt und darin haben sie ja nicht unrecht: Bislang verstehen wir nicht, wie genau Achtsamkeit diese positiven Effekte herbeiführt.
MATTHIAS DELIANO Und eben das ist der Grund, warum wir hier am LIN Studien zu Meditation durchführen. Im Grunde sind gängige Vorstellungen über das Verhältnis von Körper und Geist selbst ziemlich mystisch. Als Wissenschaftler wünschen wir uns eine ausgefeiltere Theorie, die sich in die moderne, „westliche“ Medizin integrieren lässt.
Passend dazu haben Sie, Herr Dürschmid und Herr Deliano, kürzlich untersucht, was beim Meditieren im Gehirn passiert. Was genau wollten Sie herausfinden?
STEFAN DÜRSCHMID Der Hintergrund unserer Studie ist, dass Menschen, die regelmäßig meditieren, ihre Aufmerksamkeit besser steuern und schnell hintereinander auftretende Reize besser voneinander unterscheiden können als Menschen, die nicht meditieren. Unser Ansatzpunkt war nun, zu schauen, ob diese verbesserte Informationsverarbeitung mit einem kritischen Zustand auf neuronaler Ebene zusammenfällt. Darüber hinaus wollten wir herausfinden, ob diese Effekte nur bei Menschen mit langjähriger Meditationserfahrung auftreten oder bereits, wenn jemand zum ersten Mal meditiert.
Ich glaube, das müssen Sie ein bisschen genauer erklären. Was ist in diesem Zusammenhang mit „kritischem Zustand“ gemeint?
DÜRSCHMID Die These, dass im Gehirn kritische Zustände auftreten, ist eine Vorbedingung unserer Studie. Gemeint sind Zustände, in denen das Gehirn Informationen optimal verarbeiten kann. Diese kritischen Zustände liegen zwischen chaotischen Zuständen, in denen quasi jedes Neuron mit jedem anderen Neuron Informationen austauscht, und Zuständen, in denen übergroße Ordnung im Gehirn herrscht.
Die Erfahrungen von Meditierenden passen nicht zu der Entspannungs- und Wellnessidee.
MATTHIAS DELIANO
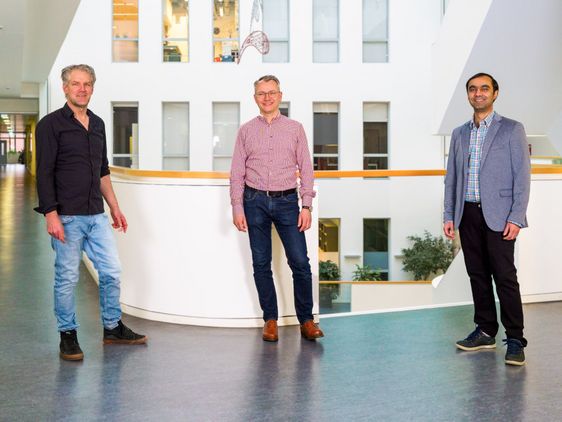

Stellen wir uns vor, Sie legten mir Ihre Messgeräte an: Was würden Sie sehen, wenn mein Gehirn gerade in einem chaotischen Zustand wäre, und wie würde sich ein „übermäßig geordneter“ Zustand äußern? Und warum ist ein Zustand wünschenswert, der genau dazwischen liegt?
DELIANO In einem neuronal relativ geordneten Zustand sind Sie beispielsweise, wenn Sie einen epileptischen Anfall haben oder auch einfach nur sehr, sehr müde sind, denn dann macht ein überwiegender Teil Ihrer Neuronen das Gleiche: Die Neuronen sprechen sozusagen im Chor, aber ohne Interaktion, es gibt keinen Dialog. Einen chaotischen Zustand wiederum kann man sich als eine Situation vorstellen, in der alle durcheinander reden und so eine Art Rauschen entsteht, „nichtssagendes Gebabbel“ sozusagen. Beide Fälle sind wenig zielgerichtet, unflexibel und nicht besonders informativ. Der lebende Organismus versucht letztlich immer, sich in einen Optimalzustand hinein zu balancieren, der zwischen diesen beiden Zuständen liegt, um flexibel und reaktiv zu bleiben. Andernfalls könnten Sie nicht auf Ihre Umwelt eingehen und nichts zielgerichtet tun.
In welchem Zusammenhang stehen solche kritischen Zustände mit Meditationsübungen?
DELIANO Hintergrund unserer Überlegung war, dass Meditierende oft angeben, dass das Meditieren ihre volle Konzentration erfordere. Und das deutet auf einen kritischen Zustand hin. Diese Aussagen stehen aber im Widerspruch dazu, dass Meditation – übrigens auch von Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftlern – häufig als reine Entspannungsübung angesehen wird, als eine Art Trance, in der man eher müde wird und die geistige Leistungsfähigkeit nachlässt. Die Erfahrungen von Meditierenden passen nicht zu dieser Entspannungs- und Wellnessidee.
Um sich auf die Suche nach kritischen Zuständen zu machen, haben Sie Menschen ohne Meditationserfahrung zu sich ins Institut gebeten und zwei Gruppen gebildet – eine Untersuchungsgruppe und eine Kontrollgruppe. Können Sie Setting und Ablauf des Experiments kurz beschreiben?
DÜRSCHMID Unsere Versuchspersonen mussten sterile OP-Kleidung anziehen und sich dann in den Magnetenzephalographen (MEG) setzen. Man kann sich so ein Gerät wie eine große Frisierhaube vorstellen, in der man mehr liegt denn sitzt und die so auf dem Kopf platziert wird, dass nur das Gesicht herausschaut. Es gab fünf Untersuchungsblöcke, die jeweils fünf Minuten lang waren. Im ersten und im fünften sollten sie gar nichts tun und konnten somit ihren Gedanken freien Lauf lassen. Im zweiten, dritten und vierten Block wurden Instruktionen eingespielt. Die Kontrollgruppe bekam Kurzgeschichten vorgelesen, die Untersuchungsgruppe wurde aufgefordert, zu meditieren – sich also auf den Atem zu konzentrieren und dabei gedanklich nicht abzuschweifen, sondern die Aufmerksamkeit immer wieder zurück auf den Atem zu lenken.
Kritische Zustände treten auch bei Menschen auf, die zum ersten Mal meditieren.
STEFAN DÜRSCHMID
Was misst die „Frisierhaube“ und in welche Art von Daten wird das übersetzt? Was sehen Sie als Forschende auf Ihrem Monitor?
DÜRSCHMID Das MEG erfasst die magnetischen Felder der von Nervenzellen erzeugten elektrischen Ströme, und zunächst haben wir da nur zappelnde Aktivität gesehen – Zackenkurven, Aktivitätswellen, aus denen wir für jeden Untersuchungsblock nach und nach versucht haben, ein einigermaßen kohärentes Bild zu gewinnen. Diese Bilder haben wir dann miteinander verglichen und geschaut, welches Bild sich in welcher Untersuchungssituation zeigt.
DELIANO Als wir die Daten dann ausgewertet hatten, konnten wir zeigen: Beim Meditieren treten tatsächlich kritische Zustände auf, jedoch nicht immer, sondern hauptsächlich im Bereich der hochfrequenten Aktivierung. Das hat vor uns so noch niemand zeigen können.
Wenn Sie sagen, in der „hochfrequenten Aktivierung“ zeigen sich Unterschiede zwischen Menschen, die meditieren, und solchen, die es nicht tun – was genau meinen Sie damit?
DÜRSCHMID Hochfrequent sind diejenigen Wellen im Gehirn, die mehr als hundertmal pro Sekunde auf und ab schwingen. Dabei werden Aktivitätsspitzen erreicht, die einen Zustand koordinierter Netzwerkaktivität anzeigen. Wir haben uns angesehen, wie diese Aktivitätsspitzen zeitlich und räumlich auf der Oberfläche des Gehirns verteilt sind. Es ergab sich eine bestimmte Häufigkeitsverteilung: Im überkritischen Zustand kann man sich die vorstellen wie eine recht flach abfallende Linie, im unterkritischen wie eine sehr viel steilere Linie. Man könnte sagen, das ist wie beim Skifahren: Die blaue, recht flache Piste ist ein überkritischer Anfängerhügel, die schwarze, sehr steile Piste ein unterkritischer Abhang. Die optimale Piste ist die rote, die genau dazwischen liegt – nicht zu steil, nicht zu flach.
DELIANO Das Skifahren ist ein ganz gutes Bild, denn zwischen all den kleinen Zacken auf unseren Kurven suchen wir nach Lawinen: Bereiche, in denen bestimmte, koordinierte Aktivitätsmuster entstehen, sich ausbreiten. Und dann schauen wir uns an, wie groß diese Lawinen sind und wie lange sie dauern. Das Ziel ist es, den Gesamtzustand der Hirnrinde zu beschreiben. Wie breiten sich Lawinen aus, lässt sich das eher als chaotisches Rauschen oder als geordnete Wellenfront beschreiben? Gefunden haben wir bei den Meditierenden etwas dazwischen, und das ist sehr interessant: Eine gewisse Ordnung, eine gewisse Komplexität ist da, aber eben nicht übermäßig.
Um im Bild zu bleiben: Das Optimum für die Skifahrerin ist sozusagen die mittelschwere Piste, nicht die allzu steile schwarze Piste und auch nicht der flache Anfängerhügel.
DELIANO Genau. Und das trifft eigentlich auch ganz gut das, was da in der Kognition passiert. Es bringt nichts, wenn man überfordert oder unterfordert ist. Stattdessen gibt es so einen Punkt dazwischen, wo ich meine Lern- und Leistungsfähigkeit optimal zum Einsatz bringe. Für meine Begriffe ist der kritische Bereich der Bereich des Flows, wie ihn der Psychologe Mihály Csíkszentmihályi beschrieben hat, aber das ist bislang nicht experimentell bestätigt worden und insofern kann ich das nicht wissenschaftlich untermauern.

Gibt es weitere wichtige Erkenntnisse, die Sie anhand der Studie gewonnen haben?
DÜRSCHMID Ein wichtiger Befund ist, dass wir nicht sagen können, dass beim Meditieren kritische Prozesse in jeder Hinsicht zu beobachten sind, da wir sie nur in den hohen Frequenzen gefunden haben. Zeigen konnten wir zudem, dass kritische Zustände auch schon bei Menschen auftreten, die zum ersten Mal meditieren. Bei ihnen gibt es ebenso wie bei Menschen mit langjähriger Meditationspraxis eine Veränderung hin zu einer optimalen Informationsverarbeitung.
Jetzt haben wir so lange über die Studie gesprochen und dabei den Dritten im Bunde sträflich vernachlässigt. Herr Chander, Sie forschen ebenfalls am LIN und beschäftigen sich seit Längerem mit Meditation und Achtsamkeit – beruflich wie privat. Warum?
CHANDER Meine Mutter ist Ärztin und hat Achtsamkeitstechniken angewendet, um Ihren Patientinnen und Patienten zu helfen. Nachdem sie gesehen hatte, wie positiv sich das auswirkt, hat sie die ganze Familie zum Meditieren ermutigt. Ich habe mit 15 begonnen und mich dann nach und nach mit verschiedenen Formen auseinandergesetzt – dem japanischen Reiki zum Beispiel, buddhistischen Meditationstechniken und einer hinduistischen Variante von Achtsamkeit. Im Prinzip haben diese Techniken alle denselben Kern: Es geht darum, das allgemeine Wohlbefinden zu steigern, die physische Leistungsfähigkeit und die autonomen Körperfunktionen zu stärken. Die Idee ist, dass ein gesunder Körper zu einem gesunden Geist führt und ein gesunder Geist zu einer gesunden Achtsamkeitspraxis.
Diese Erfahrungen haben sicherlich auch einen Einfluss auf Ihre Arbeit als Neurowissenschaftler.
CHANDER In der Tat haben Meditation und Achtsamkeit mein Leben derart verändert, dass ich in meiner Arbeit als Neurowissenschaftler sehr motiviert bin, herauszufinden, wie Achtsamkeit eigentlich funktioniert. Was passiert da im Gehirn? Kürzlich habe ich einen Meditationsclub am LIN gegründet – einerseits, damit meine Kolleginnen und Kollegen als Individuen von den positiven Wirkungen profitieren können, andererseits, um mehr darüber herauszufinden, wie diese Techniken den Körper verändern. In Studien konnte bislang unter anderem nachgewiesen werden, dass Meditation und Achtsamkeit Menschen helfen, die sich in Krebstherapie befinden, traumatische Verletzungen erlitten haben oder unter Stresssyndromen oder Depressionen leiden. Kürzlich erschien sogar eine Studie über die positiven Wirkungen bei Menschen, die sich mit Corona infiziert haben: Wer meditiert, erholt sich schneller und leidet auch weniger unter pandemiebedingtem psychischem Stress.
Achtsamkeit ist im Grunde etwas Leichtes.
BANKIM SUBHASH CHANDER
Angesichts der Wirksamkeitsnachweise ist es erstaunlich, dass Meditation und Achtsamkeit vielfach noch nicht als Behandlungsmethoden etabliert sind. Was müsste geschehen, damit sich das ändert?
CHANDER Es braucht ein besseres Verständnis für den Wirkmechanismus. Die neuen Untersuchungswerkzeuge, die wir hier am LIN im Feld der Neurowissenschaften entwickeln, helfen uns dabei, besser zu verstehen, wie diese Wirkungen zustande kommen und somit die Lücke zwischen zeitgenössischen Heilmethoden und traditionellen Praktiken zu schließen. Obwohl diese Methoden ein großes Potenzial haben und sich gut in die Schulmedizin integrieren lassen würden, ist Achtsamkeit, außer in Hinblick auf psychiatrische Erkrankungen, als Therapieform bislang noch nicht zum Standard geworden. Ich denke, dass die Studien, die wir hier am LIN durchführen, auf längere Sicht dabei helfen werden, die physischen Effekte von Achtsamkeit zu quantifizieren.
Welche Forschungsfragen zu Meditation und Achtsamkeit würden Sie gerne als nächstes angehen?
DÜRSCHMID Ein nächster Schritt wäre, zu untersuchen, wie sich die Hirnaktivität, also die Dynamiken im Gehirn während der Meditation, verändert – und zwar, wenn man einen längeren Zeitraum betrachtet.
CHANDER Ich persönlich fände es auch lohnenswert, sich auf die Suche nach einem Biomarker für Achtsamkeit zu machen. Das könnte ein Parameter sein, den wir mit Hilfe von Magnet- (MEG) oder Elektroenzephalographie (EEG) messen können, und der uns dann dabei helfen würde, über rein subjektive Berichte hinauszugehen und verschiedene Achtsamkeitstechniken zu quantifizieren, ihre Wirkungen auf Basis objektiver Daten miteinander zu vergleichen.
Was raten Sie Menschen, die sich noch nie mit Achtsamkeit und Meditation beschäftigt haben, aber gerne damit anfangen würden?
Chander: Achtsamkeit ist im Grunde etwas Leichtes. Ich treffe immer wieder auf Menschen, die diese Techniken für kompliziert halten, weil sie glauben, sie müssten dabei das Denken komplett einstellen oder sich absolut und rigoros auf eine Sache konzentrieren, von der sie aber die ganze Zeit abgelenkt werden. Tatsächlich geht es darum, den Fahrersitz zu verlassen und die Kontrolle abzugeben: Achtsam sein heißt, das was passiert, zu beobachten, ohne es zu bewerten. Sie können die Mona Lisa betrachten und dabei achtsam sein. Oder Sie setzen sich hin, schließen die Augen und konzentrieren sich auf Ihre Atmung. Wenn Sie dann von einem Gedanken abgelenkt werden, dann betrachten Sie einfach diesen Gedanken und schon sind sie achtsam. So einfach ist das: beobachten, was passiert, ohne davon gestresst zu sein. Und, so simpel das ist – Achtsamkeit ist unerlässlich für die Gesundheit. Für den Körper brauchen Sie das Fitnessstudio, für Ihre psychische Gesundheit Achtsamkeit. Um uns als Menschen weiterzuentwickeln, müssen wir aufmerksamer gegenüber uns selbst werden.



