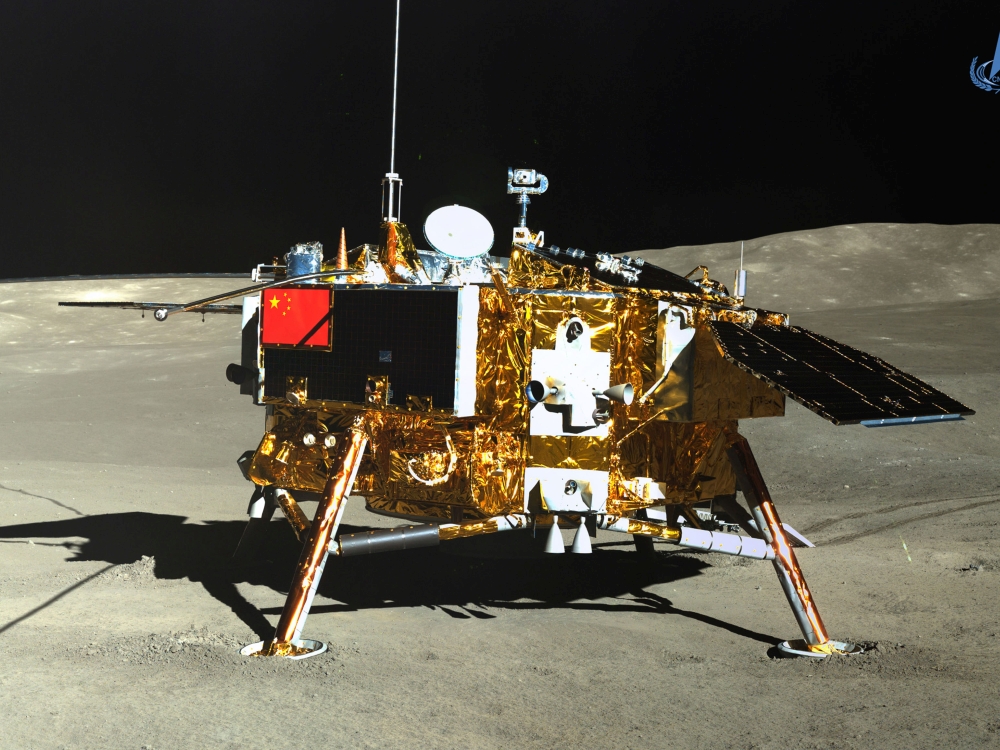LEIBNIZ Chinas Staatspräsident Xi Jinping hat angekündigt, man wolle die globale Innovations- und High-Tech-Führerschaft übernehmen. Wie gut sind die Bedingungen für Forscherinnen und Forscher in China, Herr Sachsenmaier?
DOMINIC SACHSENMAIER Insgesamt sind die Forschungsbedingungen und damit auch die Leistungen wissenschaftlicher Einrichtungen in China in den vergangenen Jahren dramatisch besser geworden. Das gilt jedoch nicht für alle Fächer gleichermaßen, sondern vor allem für die Natur- und angewandten Wissenschaften. Die chinesische Bildungslandschaft ist extrem ausdifferenziert. Es gibt eine starke Spitze, die aber sehr schmal ist. Darin gleicht China mehr den USA als Deutschland.
Sie sagen: Dramatisch verbessert
. Wie kann man sich das vorstellen?
Vor 30 Jahren hatten wir eine völlig andere Situation. China war Entwicklungsland, während Deutschland Entwicklungshilfe geleistet hat. Davon sind wir mittlerweile sehr weit entfernt. In manchen Fachrichtungen befinden wir uns auf Augenhöhe; in anderen hat sich das Verhältnis schon ins Gegenteil verkehrt. In diesen Bereichen liegt eine Kooperation inzwischen im deutschen Interesse, um nicht den Anschluss an die Weltspitze zu verlieren. In Forschungsfeldern wie Nanotechnologie, Künstlicher Intelligenz, Mathematik, Telekommunikationstechnologie oder Ingenieurswissenschaften gehören chinesische Forschungseinrichtungen zur globalen Spitzengruppe.
Naturwissenschaften sind politisch relevant, Geisteswissenschaften politisch brisant.
DOMINIC SACHSENMAIER

Und wo gelingt China dieses wissenschaftliche Überholmanöver nicht so gut?
Dies ist in einigen Fächergruppen der Fall, unter anderem in weiten Teilen der Geistes- und Sozialwissenschaften. In diesem Bereich gibt es – etwas generalisierend gesprochen – noch immer eine starke globale Dominanz von Forschungen und Theorien, die an westlichen Universitäten produziert werden, vor allem im anglo-amerikanischen Raum.
Die westliche Dominanz ist also verantwortlich für das Hinterherhinken der chinesischen Geistes- und Sozialwissenschaften?
Die Tatsache, dass chinesische Beiträge zu den Geistes- und Sozialwissenschaften im Westen noch recht wenig rezipiert werden, liegt an verschiedenen Faktoren. Sicherlich spielen auch eurozentrische Weltbilder eine Rolle – bei uns werden beispielweise auch die japanischen Geisteswissenschaften kaum wahrgenommen, selbst wenn sie in Übersetzungen vorliegen. Doch gibt es auch in China spezifische Probleme, die einer breiten internationalen Strahlkraft der chinesischen Geistes- und Sozialwissenschaften entgegenstehen. In den vergangenen Jahren ist in diesen Fachrichtungen eine deutliche Verschärfung der politischen Kontrolle zu beobachten, welche die akademische Arbeit beeinträchtigt.
Warum ist das so?
Ich würde es so formulieren: Naturwissenschaften und angewandte Wissenschaften sind politisch relevant, die Geisteswissenschaften hingegen in Teilen politisch brisant. Die Forschungsfreiräume sind in vielen Teilen der chinesischen Geisteswissenschaften sicherlich größer als man es sich hierzulande oftmals vorstellt. Dennoch ist die wissenschaftliche Redefreiheit bei einigen wichtigen Themen entschieden eingeschränkt - Beispiele sind unter anderem Taiwan, Tibet oder Xinjiang. Hierunter leidet selbstredend die internationale Reputation der entsprechenden Fachbereiche.

Wie ist es China gelungen, in den anderen Forschungsbereichen derart stark aufzuholen?
Zum einen hat die Regierung viel Geld in den Bildungssektor gesteckt, wobei proportional zur Größe des chinesischen Wirtschaftsraums auch die Möglichkeiten gewachsen sind. Man hat gezielt einige technologische und wirtschaftliche Bereiche ausgewählt, in denen man mit aller Macht an die Weltspitze will. Auch die Universitätsleitungen sind sehr ambitioniert, was den Aufbau von Forschungsmöglichkeiten und die Internationalisierung von Fachbereichen angeht. In diesem Zusammenhang wurde der Vernetzung mit globalen Spitzenuniversitäten wie auch der Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Unternehmen eine hohe Priorität eingeräumt. Ein nicht zu vernachlässigender Erfolgsfaktor ist auch der gesellschaftliche Sektor: Viele Familien ermöglichen ihren Kindern ein Auslandsstudium, was wiederum dem chinesischen Wissenschaftssystem zugutegekommen ist.
Es läuft also bestens für die Chinesen.
Nicht nur. Das Land wird große Strukturprobleme zu bewältigen haben, von denen auch der Wissenschaftssektor nicht unberührt ist. Dennoch ist der Wissenschaftsstandort China bedeutend gestärkt worden.
Und wie sieht es mit dem Austausch mit dem Ausland aus: Welche Rolle spielen ausländische Forscherinnen und Forscher in dieser Entwicklung?
Sie bleiben wichtig für die chinesische Wissenschaftslandschaft, wie dies angesichts global vernetzter Forschung auch in anderen Ländern der Fall ist. Doch in den vergangenen Jahren sind internationale Kooperationen nicht mehr unbedingt durch einen Abfluss von Wissen zugunsten Chinas charakterisiert. China bildet mittlerweile eigene Top-Wissenschaftler aus, sodass man sich immer mehr auf Augenhöhe begegnet.
Viele dieser Top-Wissenschaftler gehen dann allerdings selbst lange Zeit ins Ausland, nach Amerika oder Europa.
Und auch hier ist ein neuer Trend zu erkennen: Immer mehr kehren zurück nach China.
Warum?
Teilweise entscheiden sich Spitzenkräfte gegen eine langfristige Lebensplanung im Westen, weil ihrer Meinung nach nicht mehr auszuschließen ist, dass sich die Stellung von Minderheiten verschlechtern könnte – Erfahrungen wie die Trump-Regierung haben hierzu beigetragen. Doch werden viele auch angezogen von den guten Lebens- und Arbeitsbedingungen in China. Viele chinesische Universitäten können mittlerweile sehr gute Ausstattung, internationale Netzwerke und attraktive Gehälter bieten. Die Rückkehr nach China ist oftmals aber nicht unbedingt eine permanente Entscheidung. Gerade die Spitzenforschung ist in vielen Fächern derart mobil geworden, dass einzelne führende Forscher nicht mehr unbedingt zu einem System gehören. Sie leben und forschen mal in den USA, mal in China, dann ziehen sie weiter nach Singapur.
Für europäische und chinesische Universitäten müssen die gleichen Spielregeln gelten.
Xi Jinping hat vor einigen Monaten gesagt: Wissenschaft kennt keine Grenzen, aber jeder Wissenschaftler hat ein Vaterland.
Im Westen hingegen gilt die Freiheit der Wissenschaft. Was lässt sich aus diesen unterschiedlichen Wahrnehmungen für die Forschung ableiten?
Da muss man unterscheiden. Ohne Zweifel wird von der Regierung das Thema Patriotismus in der Wissenschaft wie auch in der Wirtschaft sehr stark betont. Aber dies bedeutet selbstverständlich nicht, dass diese Rhetorik von allen Wissenschaftlern auch so internalisiert wird.
Wie hat sich dabei die Zusammenarbeit zwischen ausländischen und chinesischen Forschern verändert?
Vor zehn, 15 Jahren herrschte noch ein großes Wissensgefälle zwischen dem Westen und China. Vielfach konnte man durchaus von einem Schüler-Lehrer-Verhältnis sprechen. Aber das ist lange vorbei. Inzwischen hat sich eine Spitzengruppe chinesischer Universitäten herausgebildet – die Tsinghua, die Peking-Universität oder auch die Fudan-Universität, die den westlichen Top-Adressen in vielen Bereichen nicht mehr nachstehen. Und damit hat sich das gesamte Gefüge verändert. Die chinesischen Spitzenuniversitäten suchen längst nicht mehr händeringend nach Partnerschaften, sondern gehen inzwischen sehr selektiv vor. In einigen Forschungsfeldern befürchten chinesische Universitäten nun selbst, Wissen und Wissenschaftler zu verlieren.
Durchaus. Aber wie steht es um die Rolle des Staates in der Forschung?
Wie bereits erwähnt, setzt der chinesische Staat in einigen Bereichen enge Grenzen, bestimmte Themen dürfen nicht offen diskutiert werden. In den anderen Sektoren wiederum fördert der Staat die Forschung dezidiert durch massive Zuwendungen. Wir müssen uns dessen bewusst sein, aber dürfen zugleich nicht ein Zerrbild von den Unterschieden zwischen China und dem Westen schaffen. Auch im Westen sind Staaten sehr stark in die Entwicklung von Spitzenforschung involviert. In den USA ist das Pentagon ein riesiger Auftraggeber. In Deutschland wurde der Impfstoff Biontech massiv vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Auch im Westen sind Staaten und Wissenschaft eng miteinander verbunden.
Ich finde es interessant, dass Sie den Corona-Impfstoff erwähnen. China hat gleich mehrere Impfstoffe wie Sinovac und Sinopharm hervorgebracht. Der große Unterschied ist aber, was nach der Entwicklung folgt. Während Biontech verteilt oder verkauft wird, startet Peking mit seinen Impfstoffen eine globale PR-Kampagne. Es benutzt die Impfstoffe, um seinen Einfluss zu stärken.
Richtig. Aber das würde ich schon nicht mehr dem Bereich Wissenschaft zuordnen, sondern den Bereichen Diplomatie, Handelsmacht und Soft Power. Darüber könnte man lange und viel sprechen. Aber in Wissenschaft und Forschung greift diese Unterscheidung aus meiner Sicht kaum.

Kommen wir zurück auf die Kooperation mit China. Sie haben über die großen Möglichkeiten von Forschung in China gesprochen. Wie sieht es mit den Risiken aus?
Die politischen Grenzen in den Geistes- und Sozialwissenschaften habe ich schon erwähnt. Es besteht die Gefahr, dass in Kollaborationen mit China bestimmte Fragen schlicht nicht mehr gestellt und gewisse Themen lieber nicht angepackt werden. Zensur und Selbstzensur können Hand in Hand gehen. In den angewandten Wissenschaften stellen sich andere Probleme. Hier stellt die Verlässlichkeit von Forschungsabkommen und auch der Umgang mit Daten und Forschungsergebnissen eine große Herausforderung dar.
Wie sollten wir im Westen damit umgehen?
Im Hinblick auf Zensur und Selbstzensur dürfen wir selbst niemals kritische Themen ausblenden und tabuisieren. Was in China passiert, ist sehr bedauerlich. Deshalb sollten wir im Zuge der Internationalisierung von Forschung Kontakte und Kräfte in der chinesischen Wissenschaft fördern, die für einen offenen Umgang mit allen Themen stehen. Und hinsichtlich des Zugangs zu Forschungsergebnissen und -daten sollten wir Abkommen mit China schließen, in denen diese Dinge klar geregelt sind. Hier ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich europäische Bildungseinrichtungen zusammentun und auch von politischer Seite unterstützt werden. Für europäische und chinesische Universitäten müssen die gleichen Spielregeln gelten.
Glauben Sie wirklich, dass man die Chinesen dazu bringen kann?
Durchaus. China ist ja nicht auf dem Weg in die Autarkie. Es handelt sich um eine Macht, die an der global vernetzten Wissenschaft partizipieren möchte und hierüber auch Erfolge definiert. Aber der Impuls für festere Rahmenabkommen muss aus Europa kommen. Wir müssen darauf pochen, dass die gleichen Bedingungen gelten.
Eine Vollsanktionierung der chinesischen Wissenschaft ist keine Lösung.
Sprechen wir über die Anwendung von Forschung. Wenn wir sehen, was in China mit Überwachungstechnik, Gesichtserkennung und Künstlicher Intelligenz schon alles gemacht wird, muss das nachdenklich stimmen. Sind Forschende in Europa und den USA hier zu blauäugig gewesen?
Man sollte immer im Blick behalten, wie Anwendungen aus der Forschung schlussendlich in der Realität eingesetzt werden. Dieser politisch-gesellschaftlichen Relevanz muss man sich bewusst sein. Auch hier braucht es klarer Rahmenabkommen. Dafür bedarf es aber eines westlichen Konsenses, der genau den Rahmen vertretbarer Forschungskooperationen festlegt. Es bringt nichts in der Sache, wenn nur deutsche Universitäten darauf dringen. Wenn sich nur deutsche Universitäten aus Kooperationen zurückziehen, dann füllen schlicht andere westliche Einrichtungen die Lücke.
Gibt es dazu schon Ansätze oder muss das Problembewusstsein erst noch geschärft werden?
Auf der politischen Ebene wird man sich dessen zunehmend bewusst. Wir erleben derzeit eine kritischere Herangehensweise an China. Hier muss schnell gehandelt werden, ohne jedoch über das Ziel hinauszuschießen und die chinesische Regierung mit der gesamten chinesischen Wissenschaftslandschaft gleichzusetzen. Eine Vollsanktionierung der chinesischen Wissenschaft ist keine Lösung. Auch sollten wir versuchen, nicht aktiv zu einer Welt rivalisierender Blöcke beizutragen.
Umgekehrt teilt China derzeit kräftig aus. Mit dem Merics-Institut in Berlin ist gleich eine komplette Einrichtung sanktioniert worden. Sieht so Zusammenarbeit aus?
Bestimmt nicht. Dazu gab es ja sofort ein Protestschreiben. Klar ist: Man darf sich diesen Sanktionen keinesfalls fügen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich eine Regierung einmischt in die Wissenschaftslandschaft in Europa. Da muss die China-Forschung geschlossen auftreten und ein klares Signal aussenden.
Sanktionen sind ein harscher Schritt, aber es gibt doch auch andere Formen der Einflussnahme aus China. Hier stehen vor allem die Konfuzius-Institute in der Kritik.
In Deutschland sind die Konfuzius-Institute so angelegt, dass sie nicht von China aus betrieben werden. Es handelt sich um Kooperationen: Das Geld kommt zwar aus China, aber die Projekte an den Universitäten werden – zumindest an den mir bekannten Standorten – immer von deutscher Seite entschieden und durchgeführt. Damit ist eine Instrumentalisierung der Inhalte eigentlich ausgeschlossen: Die chinesische Seite hat keine Möglichkeit zu entscheiden, wer eingeladen wird und wer nicht, welche Themen untersucht werden und welche nicht.
Bleibt trotzdem der Hebel Geld. China stellt finanzielle Mittel zur Verfügung, die in der deutschen Forschung dringend benötigt wird. Sie kennen bestimmt den Spruch: Wes Brot ich ess, des Lied ich sing.
Ich würde meinen, dass die meisten Institute nicht so weit gehen. Nur weil Wissenschaftler teilweise mit Mitteln aus einem bestimmten Land arbeiten, müssen sie nicht das Lied von dessen Regierung singen. Diese Souveränität sollten wir den deutschen Forschern zugestehen, und dieses Vertrauen sollte man haben. Zudem sind die Finanzquellen der hiesigen Chinaforschung divers, und dies ist auch gut so. Wir hier am Ostasiatischen Seminar Göttingen kooperieren zum Beispiel auch mit Taiwan, und viele der Kooperationen mit Forschern der VR China werden ausschließlich von hiesigen Geldgebern wie etwa dem BMBF oder der Alexander von Humboldt-Stiftung finanziert.
So ist es in Deutschland. Aber was sollten deutsche Forscher in China beachten?
In den meisten Fächern wird man auch in China einen regulären Arbeitsablauf vorfinden. In den politisch brisanten Bereichen oder in den Technologiefeldern, die im Blickfeld der Regierung stehen, sollten sich Wissenschaftler allerdings der Kontexte ihres eigenen Wirkens bewusst sein. Leider gibt es im Hinblick auf China schon ausbildungsbedingt beim Gros der Wissenschaftler große Wissenslücken, das fängt schon bei der Sprache an. Im Gegensatz hierzu sind viele chinesische Forscher schon seit ihrer Schulzeit recht eng mit dem Westen verbunden, haben oftmals einen Teil ihres wissenschaftlichen Lebens dort verbracht. So wissen chinesische Wissenschaftler viel mehr über Deutschland als umgekehrt und nehmen gewöhnlich in internationalen Kooperationen die Rolle von Brückenbauern ein. All dies erschwert natürlich die Möglichkeiten deutscher Universitäten, Kooperationen adäquat einschätzen und aktiv mitgestalten zu können. Das müssen wir ändern.
Wie?
Zumindest auf absehbare Zeit könnten Kompetenzzentren hierbei eine wichtige Rolle spielen. Denn Deutschland hat keine breite soziale Gruppe wie etwa die chinese americans in den USA, die auch in der Wissenschaft vertreten sind und häufig aus ihrer eigenen Biographie heraus schon Kenntnisse zu China mitbringen.