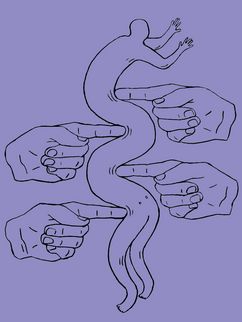Für Jim Harvey und Phil Fialer begann alles aus einer Partylaune heraus. Als die beiden Elektroingenieure Ende der 1950er-Jahre an der Stanford University einen Kurs zur »Theorie und Praxis von Rechenmaschinen« belegten, hatte das campusweite Rechenzentrum gerade einen Großrechner erworben, einen IBM 650 – massiv wie ein Bus, mit tausenden Lochkarten als Datenspeicher.
Für Harvey und Fialer war der Kurs eine willkommene Abwechslung im Studienalltag. Nicht ohne Hintersinn schrieben sie zum Jahreswechsel 1960 ihre Abschlussarbeiten über den Großrechner als ideales Werkzeug, »einsame Herzen« zu verbinden. Ihr Dating-Programm nannten sie – im moralischen Ton dieser Zeit – vorsichtshalber »Happy Families Planning Service«. Sie organisierten eine Party, zu der sie 50 männliche und ebenso viele weibliche Freunde einluden, die der Computer verkuppeln sollte. Unter den Gästen hatten sie Fragebögen verteilt, mit deren Hilfe sie Psychogramme der Probanden entwarfen: Wer wählte die Demokraten, wer die Republikaner? Wer bezeichnete sich als religiös? Wer rauchte, trank Alkohol, und wer übte welche Hobbys aus? Auf dieser Grundlage erfolgte die Zuordnung der Paare. Weil der Algorithmus noch in den Kinderschuhen steckte, kam es zu einigen wenig glücklichen Paarungen. Die Idee aber zündete – lag sie doch schon seit Jahren in der Luft.
Liebe ist nichts Mysteriöses. Sie lässt sich wissenschaftlich berechnen – elektrisch und automatisch!
Seit dem Zweiten Weltkrieg boomte das Geschäft der Ehevermittler. Alleinstehende Frauen und Männer trafen sich in den USA in Lonely Hearts Clubs. Karl Miles Wallace, Soziologe am Los Angeles State College, hatte daher 1948 einen Personal Acquaintance Service aus der Taufe gehoben. Im Zuge eines Feldversuchs brachte er über 6.000 Personen in einem solchen Club zusammen und studierte die Dynamiken der modernen Partnersuche. Wallace interessierte sich sowohl für die sozioökonomischen Hintergründe und charakterlichen Dispositionen der Singles als auch für die Ansprüche, die sie an ihre Partnerinnen und Partner in spe stellten. Um der vielen Informationen Herr zu werden, ließ er Interviews, Fragebögen und Persönlichkeitstests in maschinenlesbare Daten übersetzen, die ein Lochkartenleser der Firma Remington Rand auswertete. So wurden binnen einer Dekade rund 320 Ehen gestiftet.
Mehrere Eheanbahnungsinstitute entdeckten in der Folge die Möglichkeiten einer Vermarktung dieses neuartigen Computereinsatzes. Ein New Yorker Institut bewarb seine Dienste im Jahr 1950 ausdrücklich unter Verweis auf die »Wissenschaftlichkeit« der Methode: »Liebe ist nichts Mysteriöses. Sie lässt sich wissenschaftlich vorausberechnen – und zwar elektrisch und automatisch!«

Wo der Computer zum Einsatz kam, löste er ein klassisches Big Data-Problem: Der Rechner erfasste, verarbeitete und analysierte die wachsenden Datenmengen, die zuvor in der Kundenkartei der Heiratsbüros zusammengelesen worden waren. In vielen Agenturen war bis dato der Menschenkenntnis des Maklers entscheidende Bedeutung zugekommen. Auch die Geschäftsräume der Institute waren wenig repräsentativ. Teils aus dem eigenen Wohnzimmer heraus, arrangierten Makler eine erste Begegnung, der sich dann im Prozess des Kennenlernens die genaue Erkundung des Charakters anschließen sollte – Herz vor Verstand. Der Computer war nun auserkoren, diese Folge umzukehren.
You’ll call it romance – we call it ›Operation Match‹.
1957 gründeten die Soziologen Eric Riss und Lee Morgan in New York den »Scientific Introduction Service«. Sie nutzten ebenfalls einen Lochkartensortierer: blaue Karten für die Männer, rosa Karten für die Frauen. Bereits 1965 vermeldete die Agentur stolz, rund 300 Beziehungen pro Woche zu vermitteln; ein Drittel heiratete später. Der typische Kunde oder die typische Kundin des Büros in Manhattan war weiß, protestantisch, zwischen Ende 20 und Mitte 50 und überdurchschnittlich gebildet. Es war ein Service für Besserverdienende. Für 30 US-Dollar spuckte die IBM-Sortiermaschine bis zu zwölf Vorschläge aus. Je nach Geschlecht, Alter, Einkommen und Ansprüchen konnte der Preis auf bis zu 300 US-Dollar steigen. So waren gebildete, beruflich erfolgreiche Frauen zwischen 45 und 60 Jahren schwierig zu vermitteln; sie zahlten in der Regel mehr.
Zum Medienereignis avancierte das Computer-Dating durch den ersten Fernsehauftritt eines »Elektronen-Amors«. Im populären NBC-Quiz »People are Funny«präsentierte Showmaster Art Linkletter am 1956 einem amerikanischen Millionenpublikum den Universal Automatic Computer als Partnervermittlungsmaschine. Linkletter hatte in der Lokalpresse diverse Inserate geschaltet, um heiratswillige Singles im Raum Los Angeles zu akquirieren. Live auf der Bühne begegneten sich dann Woche für Woche Paare, die der Computer zusammengebracht hatte. Eine Kandidatin hatte sogar ihren Freund verlassen, um sich dem Urteil des Rechners anzuvertrauen. Das Magazin »Variety« kommentierte bereits vor der Ausstrahlung: »You might give up, fellers: automation has invaded the romance.« Für die Branche der Heiratsvermittler bedeutete die Sendung ein willkommenes Marketing. Im Kielwasser der ersten Experimente schwappte die Woge der Begeisterung nach Europa.
Do you think romantic love is necessary for successful marriage?
An den Hochschulen in den USA und in Westeuropa grassierte ein regelrechtes Dating-Fieber. 1965 schmiedeten drei Studenten aus Harvard mit »Operation Match« aus der Partnersuche ein weiteres Geschäftsmodell und präsentierten ihre Idee in der CBS-Quizshow »To Tell The Truth«. Binnen weniger Monate erhielten sie 8.000 Bewerbungen; 52 Prozent der Zuschriften stammten von Frauen. Zwischen 1965 und 1968 versandte die »Compatibility Research Inc.« bereits mehr als eine Million Fragebögen und verband über 100.000 Männer und Frauen. Das Nadelöhr waren die Servicegebühren des Rechners, dessen Monatsmiete in der Regel mehrere tausend Dollar betrug. Doch schnell zeigte sich: Sonntags zwischen 2 und 4 Uhr morgens kostete die Miete im IBM Service Center praktisch nichts. So gelang es den Firmengründern, ihren Dienst für nur drei Dollar anzubieten. Für fünf Dates war dies unschlagbar günstig.
Der Computer arrangierte die Blind-Dates. Zuvor mussten die Teilnehmer einen Fragebogen ausfüllen, in dem sie über ihren ethnischen Hintergrund, ihre konfessionelle Zugehörigkeit, ihre politischen Einstellungen, ihre Hobbys, ihre akademische Bildung sowie den sozialen Status ihrer Eltern und das Familieneinkommen berichteten. Aber auch intimere Fragen waren Teil der Auswahl: »Do you think romantic love is necessary for successful marriage?« Oder: »Is extensive sexual activity preparation for marriage, part of ›growing up‹?« Die Logik war simpel: In erster Linie suchte der Computer nach Übereinstimmungen. »Operation Match« eröffnete binnen weniger Monate Büros von San Francisco über Los Angeles, Detroit, Chicago und Ann Arbor bis nach New York.

In Europa produzierte die Idee des Computer-Datings ab Mitte der 1960er-Jahre Schlagzeilen. Während in der Bundesrepublik kommerzielle Anbieter das Gewerbe an sich rissen, wurde in der DDR intensiv über ein Modell »staatlicher Eheanbahnung« beraten. Zuvor hatte es bereits in Ungarn und der ČSSR erste Versuche in dieser Richtung gegeben. Auch in Moskau diskutierte man den Einsatz von EDV-Kontaktbüros. Der russische Kybernetiker Axel I. Berg hatte 1970 in der »Literaturnaia Gazeta« die Gründung solcher Büros als geeignetes Werkzeug beschrieben, um der, wie er schrieb, allerorten zu beobachtenden Vereinzelung des Menschen in der modernen Gesellschaft gegenzusteuern und das Ideal einer sozialistischen Gemeinschaft von Moskau bis Wladiwostok ins Werk zu setzen.
Die westeuropäische Presse leistete der kollektiven Euphorie derweil durch »Partnerschaftsaktionen« Vorschub. Die größte Resonanz erzielte das Münchner Jugendmagazin »twen«. Mit der Aktion »Rendez-Vous 67« versprach das Blatt, alleinstehende Leserinnen und Leser per Computer zusammenzubringen. Von Beginn an bemühte sich das Magazin, die Aktion als wegweisendes wissenschaftliches Abenteuer darzustellen. Drei Informatiker des IBM-Rechenzentrums in Frankfurt am Main zeichneten für die technische Umsetzung verantwortlich. Die Vorteile der Technik stellte das Magazinden Teilnehmerinnen und Teilnehmern klar vor Augen: »Der Computer vergleicht in einer Dreiviertelsekunde die Angaben eines Mannes mit denen von 3.000 Frauen. 100 Stunden würde ein Mensch dafür brauchen.« Verzichte man auf die Dienste des Computers, benötige man rund fünf Jahre, um eine wirklich passende Adresse aus einer Datenbank solcher Größe zu ermitteln. Angesichts des riesigen Zuspruchs kündigte »twen« bereits im November 1967 die nächste Runde an. Bis 1970 veranstaltete »twen« Dating-Partys, spendierte Hochzeitsreisen, begleitete ausgewählte Paare zu ihren Dates, bei ihrer Verlobung und in die Flitterwochen; das Magazin berichtete aus dem Alltag neu verliebter und verheirateter Paare.
Auch bei der Suche nach Liebe sitzt man nur einsam vor den Apparaten.
In der ganzen Bundesrepublik las man nun von der »programmierten Partnerwahl«. Während die »BILD«-Zeitung das »Himmelsglück« aus dem Computer pries, zeigte sich der »Spiegel« kritisch. Der Springer-Konzern gaukle den Lesern von »twen« und »Bravo« eine heile Welt vor und suggeriere der Jugend zugleich nicht nur die »Wahl« des richtigen Lebenspartners, sondern auch des dazugehörigen idealen Lebens in Ruhm und Luxus.
Zunehmend wurde der Dating-Markt skeptisch beäugt. Die Kritik richtete sich auch gegen die Individualisierung der Single-Gesellschaft, als deren sichtbarer Ausdruck die neue Computer-Dating-Kultur galt. Das »kupplerische Werk« des Computers, sinnierte die »ZEIT« Ende der 1960er-Jahre, stehe sinnbildlich für eine Ära der Kontaktlosigkeit und der Isolation des einzelnen in der Massengesellschaft. 1982 klagte die Wochenzeitung, man sitze auch bei der Suche nach Liebe nur »einsam vor den Apparaten«.
Zugleich attackierte die Phalanx der Kritiker die Aushöhlung gängiger Moralvorstellungen, allen voran die Vorstellung sexueller Freizügigkeit und die Pluralisierung der Lebensmodelle und Liebeskonzepte. Alleinerziehende Väter und Mütter, auf der Suche nach »Lebensabschnittspartnerschaften« oder offenen Beziehungen, nicht-eheliche Gemeinschaften und Patchwork-Familien stellten das Modell der bürgerlichen Kernfamilie radikal in Frage. Dass einzelne Single-Börsen – zum Leidwesen der Moralwächter – gerade auf die Relativierung der Zentralinstanz der Ehe und zum Teil sogar auf die bloße Vermittlung von Sex abzielten, verstärkte da nur die Vorbehalte.
Der Wandel der Partnervermittlung – von der »Eheanbahnung« der 1940er- und 1950er-Jahre zum Single-Dating der 1960er- und 1970er-Jahre – spiegelte somit einen tiefgreifenden soziokulturellen Wandel wider.

Ungeachtet aller Skepsis war indes auch in der Bundesrepublik der Boom der kommerziellen elektronischen Partnervermittlung durchgeschlagen. Dabei stieg die Hamburger Altmann GmbH & Co. binnen weniger Jahre zum Branchenprimus auf. Ab 1967 verlegte sich die Firma ganz auf das boomende Feld des Computer-Datings. Auch hier avancierte das Label der »Wissenschaftlichkeit« zum Kassenschlager. Zum Beirat des Instituts zählten der Kieler Bevölkerungswissenschaftler Hans W. Jürgens, der Düsseldorfer Sozialpsychologe Peter Orlik sowie der Gießener Pädagoge und Psychologe Werner Correll. Das von ihnen beworbene »Altmann-System« wurde rasch zur internationalen Marke. Aus einer Datenbank mit über 30.000 Bewerbern suchte der Computer – ein IBM 360/40 – den vermeintlich idealen Partner oder die ideale Partnerin. Dabei konnten Interessierte pro Woche bis zu zwei Partnervorschläge anfordern und so binnen drei Jahren über 300 Kontaktdaten erhalten. Zudem gab die Firma allen Kundinnen und Kunden einen Leitfaden für die erste Kontaktaufnahme an die Hand.
Indem die Agenturen in Werbekampagnen das Bild des modernen Singles zeichneten, adressierten sie zugleich ein neues Publikum. Binnen eines Jahres versandte sie rund 250.000 Partnervorschläge; 77.000 Menschen hatten schließlich Kontakte aufgenommen, etwa 13.000 »feste« Partnerschaften registrierte die Zentrale. Rund 2.500 Menschen hatten sich verlobt, 2.188 Personen geheiratet. Die kolportierte Vermittlungsquote lag bei rund 75 Prozent.
Die »Weltwoche«kommentierte euphorisch, das Hamburger Büro heile »die Krankheiten unserer kühlen Zeit in Stahl und Beton, Vereinsamung und Kontaktarmut«. In der Praxis aber ergab sich ein ambivalenteres Bild. Zwar eröffnete die neue Technik durchaus neue Spielräume. So warb das »Altmann Magazin« 1970, der Computer biete »ideale Voraussetzungen für die Gleichberechtigung partnersuchender Frauen«. Doch letztlich zerbrach das egalitäre Glücksversprechen an den Gesetzen des Marktes. Zwecks Optimierung der Vermittlungsquote basierte das »Altmann-System« von Beginn auf der Exklusion »abnormer« Teilnehmer. So wurden diverse Personen aus der Kartei ausgeschlossen – Analphabeten, Legastheniker, körperlich Behinderte und »Geistesschwache«, Bewohner von Notunterkünften, Frauen über 50 Jahre und Männer, die kleiner als 1,55 Meter waren, Personen, die mehr als zwei Kinder unter 18 Jahren hatten, Gelegenheitsarbeiter und in aller Regel auch Ausländer.
Hier erwies sich der Dating-Service als Normalisierungsmaschine und reproduzierte die bestehende soziale Ordnung. Ein Rendezvous über soziale, religiöse oder »rassische« Grenzen hinweg blieb ein Tabu. Eine Karikatur in der Londoner Zeitung »Evening News« stellte das »Match« eines asiatischen Mannes und einer schwarzen Frau als Ergebnis eines offenkundig »defekten« Computers dar.
Die Geschichte der elektronischen Partnervermittlung spiegelt ab den späten 1950er-Jahren die Sehnsüchte und Ängste des Computerzeitalters wider. Die Euphorie der ersten Jahre, die von der Idee der Planung und dem technokratischen Versprechen einer Optimierung des Privaten getragen war, wich einer wachsenden Skepsis. Horrende Gebühren, Pannen und Fehlzuordnungen erschütterten das Vertrauen in die vermeintlich kühle Logik des Computers. Hinzu kamen Querelen um eine Verletzung von Privatsphäre und Datenschutz, als einzelne Kunden begannen, die Namen und Adressen ihrer weiblichen Kontakte weiter zu veräußern. In der Bundesrepublik konstatierte ein Branchenvertreter 1973 ein massives Image-Problem.
Ab Mitte der 1970er-Jahre belebte das Fieber des Video-Datings die gescholtene Branche wieder. In den USA und in Westeuropa, wo Videotext-Systeme wie BTX, Prestel oder Minitel eine intime Kommunikation in Chatrooms ermöglichten, drängten neue, interaktive Angebote auf den Markt. Diese Singlebörsen erlaubten es Interessierten, zunehmend eigeninitiativ im digitalen Raum nach Partnern zu suchen. So etablierte sich eine Form des Datings, die in die Ära des World Wide Web vorauswies.
In seiner Rolle als »Elektronen-Amor« verlieh der Computer dem opaken Prozess des digitalen Wandels, der bis in die 1970er-Jahre eine Domäne von Spezialisten geblieben war, alltägliche Relevanz. Für eine wachsende Zahl von Menschen begann der Weg in die digitale Gesellschaft mit der elektronischen Partnervermittlung. Vor dem Hintergrund aktueller Kontroversen um ein Ende des »analogen« Datings und die Irrwege des Kennenlernens in der Ära des Internets kann uns die Geschichte des Computer-Datings daher neue Perspektiven auf den Wandel wie auch auf die Persistenz von Familienvorstellungen, Beziehungswünschen und Liebesidealen im digitalen Zeitalter vermitteln.
MICHAEL HOMBERG
war von Oktober 2019 bis September 2020 Feodor Lynen Fellow der Humboldt-Stiftung am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Seit Oktober 2020 arbeitet er dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter. In seinem Projekt »Computer in love« untersucht er, wie – lange vor Tinder & Co. – Heirats- und Partnerschaftsinstitute in Europa, Japan und den USA ab den 1950er Jahren den Computer einsetzten, um die Märkte der »einsamen Herzen« zu erobern und so unsere Vorstellungen von Partnerschaft, Ehe und Liebe im Computer-Zeitalter veränderten.