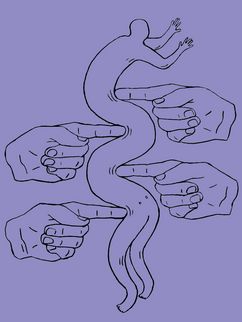Diesen Text muss ich mit einem Geständnis beginnen. Sie kennen die Schreiben mit den NGO-Logos, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit im Briefkasten liegen, besonders häufig vor Weihnachten? Oft enthalten sie persönliche Berichte, in denen etwa eine Ärztin schildert, wie sie dank einer überschaubaren Spende ein krankes Kind heilte. Und wie meine Spende in derselben Höhe ein weiteres Kind heilen könnte. Jetzt das Geständnis: Gelegentlich werfe ich diese Briefe, wenn auch schlechten Gewissens, ohne Umweg in den Papiermüll.
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch; ich finde es richtig zu spenden und tue dies auch. Aber eben nicht bei jeder Gelegenheit. Manchmal habe ich keine Zeit, die Überweisung fertig zu machen. Manchmal muss ich mich selbst um ein krankes Kind kümmern. Manchmal bin ich einfach nur faul. Eine Entscheidung ohne weitere Tragweite – für mich. Aber die meisten Hilfsorganisationen und viele andere Einrichtungen sind auf freiwillige Zahlungen angewiesen. Was also bringt Leute wie mich dazu, mehr zu spenden?
Geld verschenken, ohne eine Gegenleistung einzufordern? Zumindest in der kühlen Theorie dürfte das nicht passieren!
Um der Antwort auf diese Frage näherzukommen, besuche ich Maja Adena, Ökonomin und stellvertretende Direktorin der Abteilung »Ökonomik des Wandels« am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, dem WZB. Das Spendenverhalten der Menschen untersucht Adena bereits seit ihrer Diplomarbeit vor über 15 Jahren. In der Ökonomie wird angenommen, dass Menschen ihren Nutzen maximieren, also vorwiegend versuchen an mehr Geld zu kommen. Ich finde es interessant zu verstehen, was sie also dazu bewegt, freiwillig Geld abzugeben.
Denn genau das ist ja Spenden: Menschen verschenken Geld, ohne eine direkte, offensichtliche Gegenleistung einzufordern. Zumindest in der kühlen Theorie des rationalen Handelns dürfte das eigentlich gar nicht passieren. Warum tun wir es trotzdem?
Eine eindeutige Antwort liefern die Wirtschaftswissenschaften da nicht
, sagt Adena. Mehrere Motive kämen infrage. Eines davon lautet Altruismus. In der Ökonomie verstehen wir unter Altruismus, dass ich einen Nutzen für mich selbst darin sehe, wenn es jemand anderem besser geht. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich selbst helfe oder ob dies jemand anderes tut
, sagt Adena. Ein weiteres Motiv bezeichnen wir als warm glow.
Also das gute Gefühl, das Richtige zu tun, bei dem der Nutzen für die spendende Person rein aus dem Akt des Gebens kommt. Damit verwandt, aber nicht identisch, erklärt mir Adena, seien verschiedene Image-Motive:Menschen möchten ein positives Bild von sich selbst haben: das self image. Gleichzeitig sollen auch andere dieses positive Bild – als social image – wahrnehmen. Und schließlich spielen auch gesellschaftliche Normen eine Rolle, etwa dass man hilfsbereit sein sollte. Wer davon abweicht, erzielt in der Sprache der Ökonomie einen negativen Nutzen für sich selbst. In Alltagsdeutsch übersetzt: Er oder sie bekommt ein schlechtes Gewissen.
Die meisten dieser Motive kenne ich aus eigener Anschauung. Aber dass ich anderen helfen möchte und ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich es nicht tue, bedeutet eben noch nicht, dass ich auch wirklich spende. Hier kommt nudging ins Spiel. Übersetzt bedeutet der Begriff so viel wie Stupsen. Gemeint sind softe Anreize; Menschen sollen sozusagen auf freundliche Weise dazu gebracht werden, etwas zu tun – unterhalb der Schwelle von Ge- oder Verboten. Ein bekanntes Beispiel sind die Spendenbriefe selbst, mit denen Nichtregierungsorganisationen auf ihren Bedarf aufmerksam machen. Wie genau solche Schreiben ausgestaltet sein müssen, damit möglichst viele Menschen möglichst viel Geld spenden, macht einen Großteil von Adenas Forschung aus.


Ich habe sie gebeten, mir quasi live vorzuführen, wie sie die Spendenbereitschaft der Menschen untersucht. Aber das ist gar nicht so einfach: Wenn Ökonomen experimentieren, raucht und knallt es nicht; meist gibt es auch keine Gleichung, die – wenn sich die Hypothesen als korrekt erweisen – am Ende aufgeht. Die Art von experimenteller Wirtschaftsforschung, die Adena betreibt, besteht darin, das, was in den Köpfen der Menschen zu Entscheidungen führt, in messbare Daten zu übersetzen.
Adena bittet mich an ihren Schreibtisch. Auf ihrem Laptop flimmert ein Text über einen Taifun, der in Japan zwei Menschen getötet hat: nüchtern, sachlich, voller Zahlen und Fakten, ein klassischer Nachrichtentext. Ich beantworte etwa 60 Fragen; die meisten beziehen sich auf den Inhalt des Textes. Weil ich mit einer Probeversion arbeite, fehlt die letzte Partie, quasi der Schlussstein des Experiments: Wie viel eines vorgegebenen Betrages bin ich bereit, für die Opfer dieser Katastrophe zu spenden? Wohlgemerkt: bin – im Gegensatz zu wäre. Die tatsächlichen Probanden werden nämlich später über echtes Geld entscheiden. Was sie nicht spenden, nehmen sie mit nach Hause.
Andere Gruppen in dieser Versuchsanordnung werden ebenfalls Texte über Katastrophen lesen. Diese aber werden von Betroffenen handeln, ihre Namen nennen, ihr Leid beschreiben. In wiederum anderen werden Prominente zum Spenden aufrufen. Zum Schluss werden die Forschenden vergleichen, welche Art Text zu welchem Spendenaufkommen geführt hat.
Im Labor können wir solche Alternativen kontrolliert gegenüberstellen
, sagt Adena. Aber das hat immer den Nachteil, dass unsere Probanden nicht unvoreingenommen sind. Sie wissen, dass sie an einem Experiment teilnehmen.
Außerdem seien die meisten von ihnen Studierende, stellten also weder einen Querschnitt durch die Gesellschaft noch durch die Gruppe der Spendenden dar.
Um diese Schieflage zu vermeiden, haben Adena und ihre Forschungsgruppe eine Datenquelle erschlossen, die dort sprudelt, wo Menschen wirklich spenden: an der Semperoper in Dresden. Die engagiert sich neben ihrem Bühnenprogramm auch in der frühkindlichen musikalischen Bildung, tourt etwa mit der halbstündigen Mini-Oper »Nils Karlsson Däumling« – Sopran und eine Geige – durch Dresdener Kitas. Die Besucher der Oper erhalten Post, in der sie aufgefordert werden, für solche sozialen Projekte zu spenden. Das hat den Vorteil, dass wir durch das Kaufverhalten bei den Tickets bereits ein gewisses Vorwissen darüber haben, welche Kunden besonders teure Tickets kaufen oder besonders treue Opernkunden sind.
Wenn Sie gleich beim ersten Mal 50 Euro spenden, geben Sie nächstes Jahr wahrscheinlich genauso viel.
MAJA ADENA
Genau genommen erhalten die Kundinnen nicht einfach Post, sondern ein wirtschaftswissenschaftliches Forschungsinstrumentarium – dies allerdings im Gewand eines gewöhnlichen Spendenaufrufs. In einem Feldversuch etwa gestalteten die Ökonomen die Bitte um finanzielle Zuwendung folgendermaßen: Frühere Unterstützer sollten erneut spenden, bekamen nun allerdings einen anderen Betrag vorgeschlagen. Überschreite die Zuwendung diesen Betrag, so das Anschreiben, werde sie aus dem Topf einer anonymen Großspende um zehn Euro aufgestockt. Die Summe, die den jeweiligen Opernbesuchern vorgeschlagen wurde, wich aber nicht stets um denselben Prozentsatz von ihrer vorangegangenen Spende ab. In manchen Briefen schlugen die Wissenschaftlerinnen eine geringere Summe vor, in manchen ein Viertel mehr, in manchen das Doppelte. Als die Forschenden die Höhe der Spenden auswerteten, die daraufhin flossen, beobachteten sie: Die tatsächliche Zuwendung fiel am höchsten aus, wenn der vorgeschlagene Betrag 50 bis 75 Prozent über dem zuletzt tatsächlich gespendeten Betrag lag.
Diese Kleinteiligkeit der Erkenntnisse, die Adena und ihre Kolleginnen und Kollegen über das Spendenverhalten der Deutschen gewinnen, ist typisch. Ein Hinweis auf einen anonymen Großspender, wie ihn auch der bereits erwähnte Bittbrief enthielt, führt etwa bei vielen Empfängern zu einer erhöhten Spendenbereitschaft – nicht aber bei jenen, die am meisten Geld für Opernkarten ausgeben, mithin also die wohlhabendsten Adressatinnen sein dürften.
In einem anderen Fall ließ sich durch einen vergleichsweise hohen Spendenvorschlag von 200 Euro zwar die durchschnittlich überwiesene Summe steigern. Viele Personen mit knapperem Budget schreckte der hohe Betrag dagegen ab, sie spendeten gar nicht. Und die besonders Großzügigen, die unter anderen Umständen vielleicht 500 oder gar 1.000 Euro gegeben hätten, passten ihre Spende dem Vorschlag an. Am Ende war kaum mehr im Topf als ohne den 200-Euro-Stupser.
Das ist ein wichtiges Ergebnis unserer Forschung: Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf Spendenaufrufe
, sagt Maja Adena. Wer eine höhere Gesamtsumme erzielen möchte, muss die verschiedenen Typen von Spendern erkennen und so ansprechen, dass es ihre Zufriedenheit steigert.
Was nicht unbedingt bedeutet, dass NGOs ihre potenziellen Spender gründlich durchleuchten müssten, um deren Spendenbereitschaft zu erhöhen (das wäre allein schon aus Gründen des Datenschutzes unmöglich).
SPENDEN IN DER KRISE?

Wie hat eigentlich die Corona-Pandemie unsere Hilfsbereitschaft beeinflusst? Als COVID-19 Anfang 2020 in Deutschland ankam, kauften Menschen wie selbstverständlich für bedürftige Nachbarn ein, spendeten Lebensmittel an Tafeln oder nähten Stoffmasken für das Pflegeheim nebenan. Gleichzeitig gerieten Hunger, Flucht und Armut in anderen Teilen der Welt aus den Augen. Hilfsorganisationen begannen deshalb, ihre Spendenaufrufe durch Verweise auf COVID-19 zu ergänzen – selbst wenn ein Projekt gar nichts mit der Pandemie zu tun hatte. Ob sie Menschen so dazu bewegen konnten, mehr Geld zu spenden? Maja Adena und ihr Kollege Julian Harke haben es in einem großangelegten Onlineexperiment untersucht. Sie fanden heraus, dass sich die Spenden um 8 Prozent erhöhten, wenn ein Hinweis auf die Pandemie enthalten war. Ähnlich wirkten sich hohe Infektionszahlen in den Gemeinden der Studienteilnehmenden aus, und auch wenn die lokalen Medien intensiv darüber berichteten, wuchs das Spendenaufkommen. Für die Spenderinnen und Spender in Adenas und Harkes Experiment stand allerdings trotzdem nicht der vor der eigenen Haustür stattfindende Kampf gegen COVID-19 im Fokus, beobachteten die Ökonomin und der Ökonom vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Stattdessen waren sie auch weiter bereit, Geld an internationale Projekte zu spenden.
Unsere Beobachtung, dass reiche potenzielle Geber von der Erwähnung eines Großspenders abgeschreckt werden
, sagt Adena, lässt sich zum Beispiel ganz einfach in der Praxis nutzen: In Postleitzahlengebieten mit sehr hohem durchschnittlichem Einkommen sollte man auf eine solche Erwähnung lieber verzichten.
Auf dieselbe Weise könne etwa die Erkenntnis umgesetzt werden, dass sich das Spendenverhalten mit dem Alter ändert: Der klassische Bittbrief würde demnach so designt, dass er eher Ältere anspricht, der Spendenaufruf in sozialen Medien sei hingegen explizit auf Jüngere zugeschnitten.
Eine ganz allgemeine Erkenntnis gibt es übrigens doch. Die erste Spendenanfrage ist die wichtigste
, sagt Adena. Sie stelle die Weichen für das weitere Verhalten einer Person. Wenn Sie gleich beim ersten Mal 50 Euro spenden, geben Sie nächstes Jahr wahrscheinlich genauso viel.
Dasselbe gelte umgekehrt für niedrige Beträge: Dass jemand von zehn auf 100 Euro erhöht, sei auch bei geschicktem Nudging äußerst unwahrscheinlich.
Am Tag, nachdem ich Maja Adena besucht habe, war in meinem Briefkasten Post von »Save the Children«. Ich war neugierig, welche Nudging-Techniken er enthält (zum Beispiel mehrfach die persönliche Ansprache »Lieber Herr Kretz« sowie drei Vorschläge für Spenden, die alle erstaunlich weit über dem Betrag lagen, den ich intuitiv gewählt hätte). Der Brief lag noch eine Weile auf meinem Schreibtisch. Dann habe ich überwiesen.