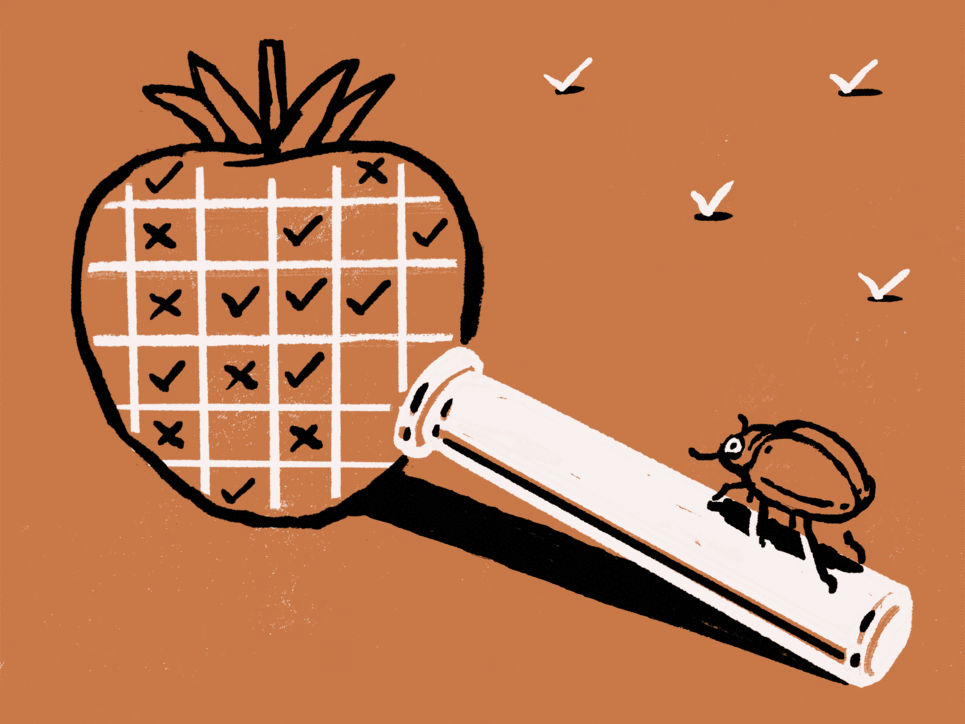Sie sind kleiner als Bakterien, chemisch oft äußerst reaktionsfreudig und man kann sie aus so gut wie jedem Ausgangsmaterial herstellen: Nano- und Mikropartikel zeichnen sich durch eine Vielzahl komplexer Eigenschaften aus, was sie für die Forschung ebenso wie für die Entwicklung neuer Technologien extrem interessant macht. Wie sich dabei Risiken minimieren lassen und ein verantwortungsvoller Umgang mit Nanopartikeln gewährleistet werden kann, untersucht der Leibniz-Forschungsverbund Nanosicherheit, an dem sieben Leibniz-Institute beteiligt sind. Fünf Einblicke in die Arbeit des Konsortiums.
Vorbeugen statt nachsorgen
Rieselhilfen im Salz, rotgoldschillernde Farbpigmente, Dieselabgase: Im Alltag kommen wir mit unzähligen Nanopartikeln in Berührung. Angesichts ihrer vielfältigen Eigenschaften und Wirkungen, die von gesundheitsschädlich bis vollkommen harmlos reichen, kann man sie nicht über einen Kamm scheren. Eines jedoch haben alle Nanopartikel gemeinsam: Aufgrund ihrer Größe werden sie schnell eingeatmet und dringen leichter als andere Partikel in bestimmte Zelltypen vor
, sagt die Zellbiologin Annette Kraegeloh vom Leibniz-Institut für neue Materialien (INM) in Saarbrücken. Bevor neuartige Nanomaterialien auf den Markt kommen, müssen sie daher sorgsam auf gefährliche Wirkungen hin untersucht werden. Aktuell liegt der Fokus im Entwicklungsprozess zuerst auf der Funktion, die das Material später einmal erfüllen soll. Die Entwicklung ist dann meist schon weit fortgeschritten und es sind Millionen geflossen, bevor die Prüfung auf Umweltwirkungen beginnt.
Doch was, wenn sich der Stoff nun als gefährlich herausstellt, unerwünschte Auswirkungen auf Gesundheit oder Umwelt zeigt? Um solche unwirtschaftlichen Situationen auszuschließen, entwickeln die Biologin und ihr Team einen Ansatz, den sie Safer by Design nennen. Er sieht vor, bereits früh im Entwicklungsprozess Informationen zu möglichen Auswirkungen zu erheben und sie beim Partikeldesign zu berücksichtigen. Dabei gelte es, sorgfältig abzuwägen zwischen Partikeleigenschaften, die für die Funktion wichtig und Eigenschaften, die für die Sicherheit relevant sind, so die Forscherin. Das konkrete Design müsse dann Ergebnis dieses Abwägungsprozesses sein. Damit das gelingen kann, braucht es detaillierte Kenntnisse über die Zusammenhänge zwischen Struktur und Funktion sowie Struktur und sicherheitsrelevanten Eigenschaften
, sagt Annette Kraegeloh. Hier besteht noch Forschungsbedarf.
Zukünftig könne es womöglich gelingen, Safer by Design sehr früh im Entwicklungsprozess anzuwenden und sogar Vorhersagen zu machen. Einen Leitfaden zu Safer by Design wollen Kraegeloh und ihr Team demnächst veröffentlichen. Im Optimalfall entwickeln sich die Dinge dann so, dass nach und nach keinerlei problematische Materialien mehr entwickelt werden.

Toxischer Torpedo
Giftig? Wie praktisch! Im Kontext bestimmter Anwendungen sind toxische Wirkungen von Nanopartikeln durchaus erwünscht – etwa im medizinisch-therapeutischen Bereich. Im Rahmen eines EU-Projekts gelang es Forschenden kürzlich, mit Nanomaterialien gezielt Krebszellen abzutöten. Beteiligt waren unter anderem Lutz Mädler und sein Team vom Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien (IWT) in Bremen. Als Verfahrenstechniker beschäftigen wir uns unter anderem mit der Entwicklung neuer Nanomaterialien
, erklärt der Forscher. In diesem Projekt war unsere Herausforderung, mittels Safer by Design giftige Nanopartikel so zu verändern, dass sie im Körper ein ganz bestimmtes Auflösungsverhalten zeigen, um sie als Medikament einsetzen zu können.
Mädler und sein Team experimentierten mit unterschiedlichen Stoffzusammensetzungen, stellten komplexe Berechnungen an und überprüften ihre Annahmen schließlich im Tierversuch. Und tatsächlich: Mit Hilfe von Nanopartikeln aus einem fein abgestimmten Kupfer- und Eisengemisch konnten die Forschenden an Krebs erkrankte Mäuse gezielt von Tumoren befreien. Diese speziellen Nanopartikel werden im gesamten Organismus besonders gut transportiert,
erklärt der Wissenschaftler. Sie zeigen aber je nach Gewebe ein unterschiedliches Auflösungsverhalten: Im gesunden Gewebe lösen sie sich langsamer auf - das kann der Körper der Mäuse gut verkraften. Im Tumorgewebe aber lösen sie sich so schnell auf, dass die Tumorzellen vergiftet werden und absterben.
Dass es seinem Team gelang, den Prozess am Computer zu modellieren und mittels Differentialgleichungen vorherzusagen, freut den Wissenschaftler besonders. Wir haben nochmal ein ganz anderes Verständnis davon gewonnen, wie sich solche Partikel verhalten. An diesem Erfolg zeigt sich auch das enorme Potenzial interdisziplinärer Forschung in diesem Bereich.
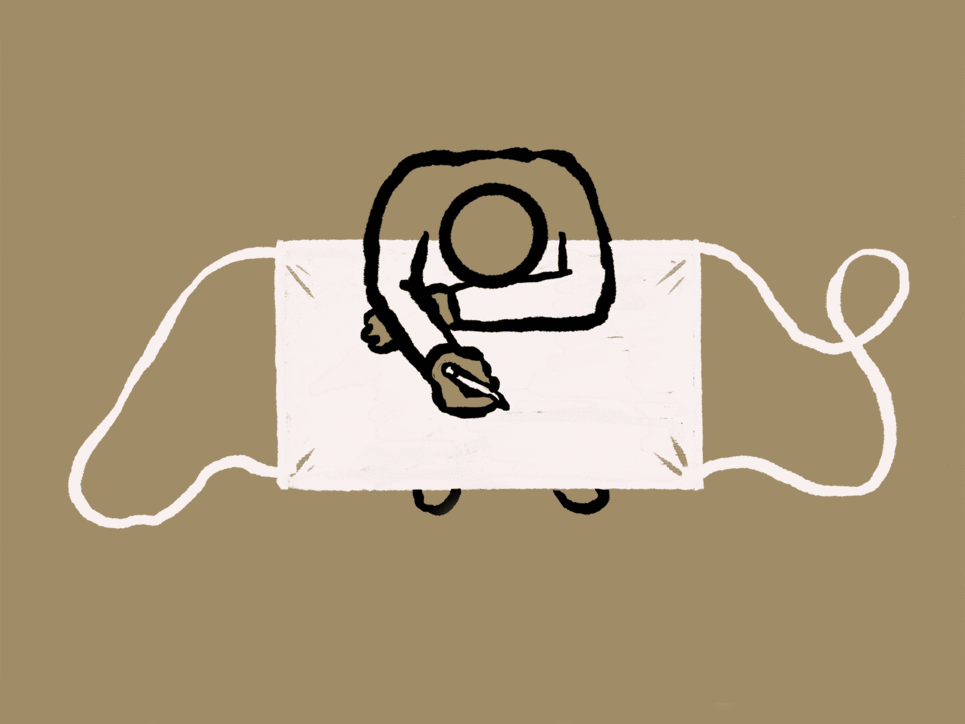
In-vitro-Darm
Ob Nanopartikel giftig sind oder nicht, sieht man ihnen leider nicht an. Problematische Wirkungen offenbaren sich in der Regel erst in aufwändigen Tierversuchsreihen, die in der Forschung zu Nanomaterialien daher bislang als unverzichtbar gelten. Nach Alternativen suchen Roel Schins und sein Team am Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung (IUF) in Düsseldorf. Sie entwickeln leistungsfähige In-vitro-Modelle – künstliche Umgebungen also, die die Bedingungen im lebenden Organismus möglichst realistisch nachstellen sollen. Die Hoffnung der Forschenden: Viele Tierversuche könnte man künftig durch Versuche an In-vitro-Modellen ersetzen. Das würde Tierleid reduzieren, die Prüfung von Nanomaterialien beschleunigen und die Kosten senken. Aktuell arbeiten wir zum Beispiel an einem Modell des menschlichen Darms
, sagt Roel Schins. Aufgebaut ist dieses Modell aus Saumzellen – für den Dünndarm typische Oberflächenzellen –, aus schleimproduzierenden Zellen sowie aus Zellen des Immunsystems, die bei der Reaktion des Darms auf Kontakt mit bestimmten Nanopartikeln eine wichtige Rolle spielen. Die Zellreaktionen im Modell vergleichen wir dann mit Ergebnissen aus Tierversuchen und sehen so, ob unser Modell schon ähnlich reagiert oder noch verbessert werden muss.
Das Ziel des Toxikologen ist es, ein Modell zu entwickeln, das Prüfstellen weltweit problemlos nachbauen können. Die Krux: Lebendiges Gewebe besteht aus einer Vielzahl von Zelltypen, und es laufen unzählige Prozesse darin ab. Allzu einfache Modelle verfälschen also die Ergebnisse, zu komplexe lassen sich dagegen nicht zuverlässig reproduzieren und sind damit unbrauchbar. Was wir brauchen sind einfache, aber leistungsfähige Modelle: Wir können Versuche an Tieren nur ersetzen, wenn unsere In-vitro-Modelle ähnlich gute oder sogar bessere Ergebnisse als Tiermodelle liefern.
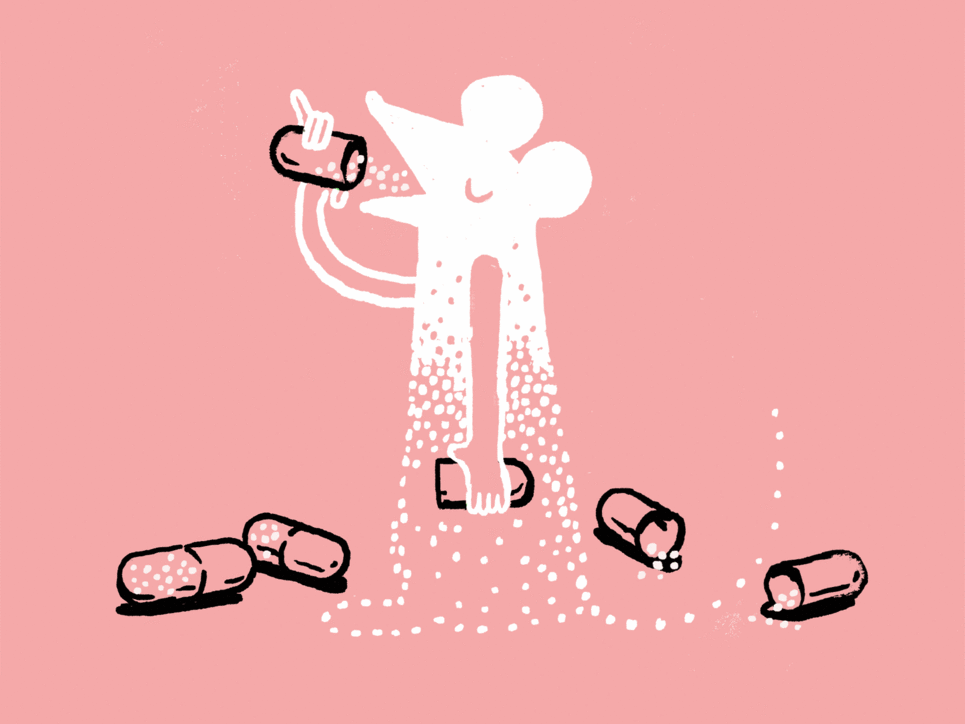
Stadt, Land, Fluss: Achtung, Mikroplastik!
Mikroskopisch kleine Kunststoffpartikel erobern den Planeten: Da sich viele Kunststoffe in der Umwelt nur langsam abbauen, sammeln sie sich in Böden und Gewässern. Allein in die Ozeane sollen seit 2016 zwischen 27 und 67 Millionen Tonnen gelangt sein. Zum massenhaften Auftreten von Mikroplastik tragen hauptsächlich der Abrieb von Autoreifen und Kunststoffe zur Einmalverwendung bei – etwa aus der Gruppe der Polyolefine, aus denen zum Beispiel Plastiktüten hergestellt werden
, sagt Brigitte Voit, Wissenschaftliche Direktorin des Leibniz-Instituts für Polymerforschung (IPF) in Dresden. Welche Folgen das hat, ist bislang weitgehend unklar – was auch daran liegt, dass den Ausgangsmaterialien häufig Additive, wie Flammschutzmittel, Verarbeitungshilfsmittel oder Füllstoffe zugesetzt wurden. Kürzlich konnten wir zeigen, dass sogar Mikropartikel desselben Basis-Kunststoffs sehr unterschiedlich mit ihrer Umwelt wechselwirken können – je nachdem, welche Additive zugegeben wurden und wie die Oberfläche des Partikels beschaffen ist
, berichtet Voits Kollege Andreas Fery. Die Diskussion um Mikroplastik muss also noch viel differenzierter geführt werden, als bislang gedacht.
Mittels Grundlagenforschung wollen die IPF-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese differenzierte Debatte ermöglichen: In einer Vielzahl von Projekten untersuchen sie nicht nur die Abbauprozesse von Mikroplastik in Gewässern, sondern auch, welche unterschiedlichen Arten und Mengen sich darin befinden. So können dann spezielle Analysemethoden und Filtertechniken entwickelt werden. Als Teil eines internationalen Konsortiums im Projekt »microplastiX« sind die Forschenden aktuell etwa dabei, mittels Spektroskopie und mit Hilfe der Software »GEPARD« Proben aus dem Atlantischen Ozean zu untersuchen. Die von uns entwickelte Software bestimmt schnell und zuverlässig Menge, Größe und Arten von Kunststoffpartikeln in einer Umweltprobe
, erklärt Brigitte Voit. Mit Hilfe dieser und weiterer Analysemethoden wollen die Forschenden Gewissheit über die Mikroplastikbelastung der Meere gewinnen, Verbreitungsmechanismen besser verstehen und Methoden zur besseren Überwachung des Plastikeintrags in die Meere entwickeln. Unter anderem auf Basis der hier gewonnenen Erkenntnisse planen die Forschenden im Sonderforschungsbereich »Mikroplastik« nachhaltige Polymermaterialien der Zukunft zu entwickeln.
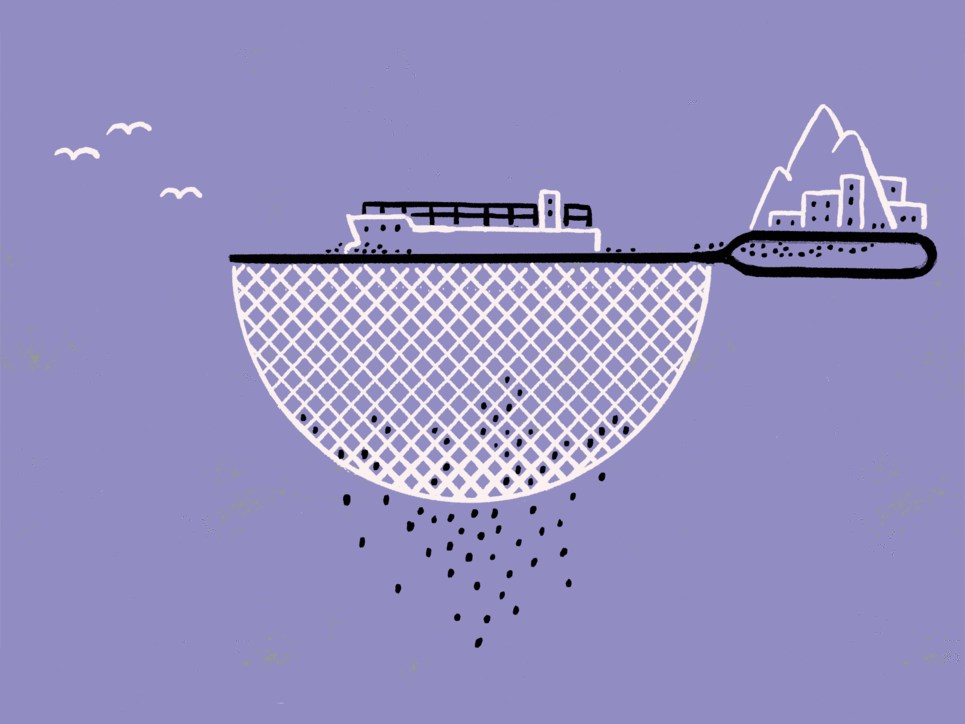
Verknüpfte Daten für sichere Vorhersagen
Etliche neue Nanomaterialien werden jedes Jahr in Verkehr gebracht, doch für bestimmte Anwendungen werden nur wenige zeitnah zugelassen. Stattdessen nimmt die Risikobewertung oft Monate oder sogar Jahre in Anspruch und fällt zuweilen dennoch lückenhaft aus. So gibt es etwa im Lebensmittelbereich nur eine Handvoll Nanomaterialien, für die überhaupt ein Grenzwert festgelegt worden ist
, sagt Christoph van Thriel vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung (IfADo) in Dortmund. Das liegt auch daran, dass man nicht für jedes einzelne Material eine qualitätsgesicherte, toxikologische Studie machen kann. Das wäre einfach viel zu teuer, viel zu aufwändig und mit Blick auf die vielen Tierversuche, die dazu nötig wären, auch ethisch nicht vertretbar.
Wie die Sicherheitsbewertung dennoch gelingen kann, untersucht van Thriel mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Leibniz-Forschungsverbund Nanosicherheit im Projekt »NanoS-QM«. Die Idee: Die Forschenden wollen Qualitätsstandards für das Ablegen und geschickte Zusammenführen bereits existierender Forschungsdaten erarbeiten. Mittels Datenabgleich soll es möglich werden, Stoffe miteinander zu vergleichen und so mögliche gesundheitsschädliche Effekte bereits existierender ebenso wie neuer Materialien vorherzusagen. Wir glauben, dass man das Rad nicht immer wieder neu erfinden muss, sondern auf existierende Daten zurückgreifen kann.
Dazu bedürfe es jedoch mehr Transparenz und einer gesteigerten Datenqualität: Firmen, die Versuche mit Nanomaterialien machen, müssten Ergebnisse nicht nur gut dokumentieren, sondern auch bereit sein, sie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Was wir dringend brauchen, sind große Repositorien und Datenbanken, in denen wir all diese Informationen zusammenziehen und mittels Machine Learning und KI auf Muster untersuchen
, sagt der Neurotoxikologe.