LEIBNIZ Herr Muskatewitz, am 1. Januar ist die zweite Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft getreten. Ihr Hauptziel ist es, behinderten Menschen mehr Selbstbestimmung und Teilhabe zu sichern. Die Bundesregierung feiert die Reform als Erfolg. Sehen Sie das genauso?
JÖRG MUSKATEWITZ Die Änderungen sind aus meiner Sicht größtenteils Make-up. Man hat versucht, alte Paragraphen in die Neuzeit zu holen, Begrifflichkeiten wurden nur dem »State of the Art« angepasst.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Der Paragraph 83, der früher »Integrationsvereinbarung« hieß, ist jetzt die »Inklusionsvereinbarung«. Inhaltlich hat sich aber überhaupt nichts geändert. Da ist einfach nur das Wording aufgefrischt worden. Auch aus der Sicht des Netzwerks der Leibniz-Schwerbehindertenvertretungen ist die Reform enttäuschend. Wir hatten uns eine Stärkung der Vertretungen gewünscht.
Stärkung im Sinne von mehr Mitspracherecht in Instituten und Betrieben?
Es geht vor allem darum, die Schwerbehindertenvertretungen von der Arbeit zu befreien. Es ist sicherlich ein kleiner Fortschritt, dass mittlerweile 100 schwerbehinderte Beschäftigte dazu führen, dass die Vertrauensperson freigestellt wird. Vorher lag die Grenze bei 200 schwerbehinderten Personen. Vertretungen in großen Unternehmen mögen davon profitiert haben, aber die kleineren, in denen weniger schwerbehinderte Beschäftigte arbeiten, stehen immer noch vor demselben Problem.
Sie müssen die eigene Arbeit und die für die Schwerbehindertenvertretung unter einen Hut bekommen.
Genau. Die Zeit, die die Vertrauensperson benötigt, steht in Konflikt mit den Arbeitsaufgaben. Das heißt, ich muss mich immer entscheiden: Mache ich jetzt etwas für die Schwerbehindertenvertretung oder arbeite ich einen anderen Punkt ab, damit mein Schreibtisch leerer wird? Das ist gerade in der Privatwirtschaft schwierig, aber auch in Forschungseinrichtungen.
AUSGESCHLOSSEN
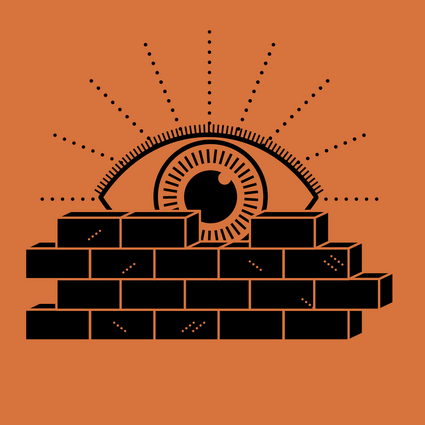
Mehr als zehn Millionen Menschen mit Behinderung leben in Deutschland, knapp acht Millionen von ihnen mit einer anerkannten Schwerbehinderung. Der Arbeitsmarkt schränkt sie in ihren Möglichkeiten teils massiv ein. Dabei geht es nicht nur um Barrierefreiheit in Form von Blindenschrift oder Rollstuhlrampen, sondern auch um die Barrieren in den Köpfen. Im Kollegium und in Vorstellungsgesprächen sehen Menschen mit Behinderungen sich immer wieder mit diesen konfrontiert. Sie suchen durchschnittlich 109 Tage länger nach Arbeit und sind doppelt so häufig arbeitslos. Dahinter stecken häufig Vorurteile bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit oder auch die mangelnde Bereitschaft von Arbeitgebern, die Aufgaben an die Möglichkeiten der Betroffenen anzupassen. Auch die Pflichtquote von fünf Prozent schwerbehinderter Beschäftigter wird häufig nicht durchgesetzt. Von den 137.000 hierzu verpflichteten Betrieben nehmen 37.500 Ausgleichszahlungen in Kauf, statt einen Menschen mit Schwerbehinderung einzustellen.
Wie ist es bei Ihnen am Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung?
Ich habe das Glück, dass mir viele Freiheiten eingeräumt werden und ich mir meine Aufgaben selbstständig einteilen kann.
Mit welchen Fragen und Problemen kommen die behinderten Menschen am Institut denn zu Ihnen?
Unser Institut zieht bald in einen Neubau um. Das beschäftigt die Menschen und sie kommen mit vielen Fragen zu mir. Die Blinden und Sehbehinderten zum Beispiel kennen den Weg von ihrer Wohnung zu ihrem aktuellen Arbeitsplatz — aber nicht den zu ihrem neuen. Sie müssen ihn mit einem Mobilitätstrainer lernen. Jetzt ist da noch eine riesige Baustelle, teilweise ohne festen Untergrund. Und an einigen Stellen wird sich bestimmt auch noch etwas am Verlauf der Wege ändern. Deshalb müssen sie sich gedulden, bis das Training losgehen kann.
Gibt es auch Probleme, mit denen Sie in Ihrem Arbeitsalltag immer wieder konfrontiert werden?
Ein Dauerproblem ist die Barrierefreiheit bei Software. Wenn Programme aktualisiert werden, führt das meist dazu, dass die Texterkennung für blinde Menschen nicht mehr funktioniert. Manchmal ist es aber auch einfach die Unachtsamkeit der Kollegen: Sie gehen zum Kopierer, ziehen das Dokument über den Scanner und leiten es als PDF-Datei weiter. Das ist dann eine Bilddatei, und die kann ein blinder Mensch auch mit einem sogenannten Screenreader nicht unmittelbar lesen. Für solche Dinge muss man die Kollegen erst einmal sensibilisieren.
In anderen Bereichen des Alltags ist das sicher nicht anders.
Auch da haben wir noch ein gutes Stück Weg vor uns. Schauen sie sich an, wie unsere Gesellschaft mit Krankheit und Tod umgeht. Das ist oft stigmatisierend: Menschen bringen keine Leistung, wenn sie krank sind und werden als Last angesehen. Sie können ihre Promotion nicht fortsetzen, wenn sie eine chronische Erkrankung haben, die in Schüben kommt. Und diese Verzögerung ist eben noch immer ein No-Go.
Wir haben noch einen langen Weg vor uns.
JÖRG MUSKATEWITZ
Haben Menschen mit Behinderung es in der Wissenschaft besonders schwer?
In der Wissenschaft sind sehr viele Promotionsstellen ausgeschrieben. Und man muss als behinderter Mensch zunächst eine akademische Laufbahn bewältigen — an diesen Punkt muss man erst einmal kommen. Oft ist das auch der Grund, dass Menschen mit Behinderung im wissenschaftlichen Dienst weniger vertreten sind als in anderen Bereichen.
Und über die Promotion hinaus?
Da wird es meiner Meinung nach ganz schwierig. Die Behinderung ist an diesem Punkt einer Karriere ja auch nur ein Aspekt. Eine Kollegin zum Beispiel hat ihre Elternzeit aufs Wahnsinnigste verkürzt, weil sie das Angebot auf eine Juniorprofessur erhalten hat. Sonst hätte sie diese nicht bekommen.
Gibt es denn Projekte und Ansätze in der Wissenschaft, die speziell die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen fördern?
Es gibt eine Stelle der Arbeitsagentur, die Zentrale Arbeitsvermittlung für schwerbehinderte Akademiker. Sie vermittelt Personen, die einen Hochschulabschluss und eine Behinderung haben. Zusammen mit der Uni Köln hat sie auch das Projekt »Promotion inklusive« zur Förderung schwerbehinderter Menschen auf den Weg gebracht. Diese Initiative soll es Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen erleichtern, behinderte Akademiker zu qualifizieren und deren langfristige Beschäftigungschancen zu erhöhen.
Helfen solche Programme?
Schon, aber es muss sich auch etwas in den Köpfen der Menschen verändern. Ich sage damit ja nicht, dass alle Betonköpfe sind, die überhaupt nicht willens sind, sich in die Lage behinderter Menschen hineinzuversetzen. Aber wie bereits gesagt: Wir haben noch einen langen Weg vor uns.
Was muss gesellschaftlich geschehen?
Wenn ich nur ein bis zwei Personen in einem Betrieb habe, die bereit sind, sich wenigstens einige behinderte Bewerber anzuschauen, sich ihnen gegenüber zu öffnen, wäre schon eine Menge gewonnen. Im Übrigen geht es ja auch vielen anderen Gruppen ähnlich: Leute mit Migrationshintergrund werden oft sofort aussortiert, wenn die Bewerbungen eintrudeln. Wir brauchen die Bereitschaft, auch sie kennenzulernen, uns anzuschauen, welche Expertise oder Qualifikationen sie mitbringen.




