LEIBNIZ Sie promovieren in Bremen am BIPS, dem Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie, Frau Princk. Woran genau forschen Sie?
CHRISTINA PRINCK Ich arbeite im Bereich der Pharmakoepidemiologie, beschäftige mich also mit der Sicherheit von Arzneimitteln. Wer nimmt sie ein, und welche Risiken gehen damit für verschiedene Menschen einher? In der Regel werden Medikamente nämlich an gesunden, jungen Menschen getestet. Sogenannte vulnerable Gruppen fallen da erst mal raus.
Was für Gruppen sind das?
Alte Menschen und Leute mit chronischen Vorerkrankungen zählen dazu, aber auch Kinder. Ich persönlich gucke mir Frauen im gebärfähigen Alter und Schwangere an. Mithilfe der anonymisierten Daten von 25 Millionen Krankenversicherten untersuchen wir, welche Risiken die Einnahme eines Medikaments für sie mit sich bringen kann. Auf dieser Basis können wir zum Beispiel nachvollziehen, ob eine Frau, die in der Schwangerschaft ein Medikament einnehmen musste, gesunde Kinder zur Welt gebracht hat. Wir können auch sehen, ob ihre Kinder später eventuell mehr Infektionen oder Fehlbildungen haben.
Sie selbst sind seit Ihrer Geburt gehbehindert.
Ich wurde mit einem zwei Zentimeter zu kurze Bein geboren. Ich bin normal gewachsen, das Bein stark verlangsamt. Um es zu verlängern, wurde ich im Laufe meines Lebens mehrfach operiert. Bei einer dieser OPs wurde dann auch noch mein Knie massiv geschädigt. Über lange Phasen konnte ich mich wegen meiner Behinderung nur mit Gehstützen fortbewegen oder musste sogar zu Hause bleiben. Jetzt kann ich wieder relativ normal laufen, aber immer mit einer Art Grundschmerz.
Inwiefern hat Ihre Geschichte die Entscheidung für Ihr Fach beeinflusst?
Ich will kranken Menschen helfen, will etwas Sinnvolles tun. Aber ich war selbst so oft im Krankenhaus und in Behandlung, dass mir klar war: Ich will nicht Ärztin werden, sondern einen anderen Ansatz finden. Meinen Beruf habe ich mir auch wegen meines pharmazeutischen Hintergrunds ausgesucht: Ich musste im Leben viele Schmerzmittel nehmen und wollte wissen, was ich da nehme und was es mit meinem Körper macht. Außerdem hatte ich die Hoffnung, im Gesundheitsbereich auf Akzeptanz zu treffen.

Wie meinen Sie das?
Es gibt ja diese abwertende Nutzung des Wortes Behinderung. »Du bist doch behindert!« Manchen Menschen fehlt das Bewusstsein dafür, dass Menschen mit Behinderung genauso viel wert sind wie alle anderen. Mein Gedanke nach dem Abitur war: In einem Bereich, in dem es so zentral darum geht, Menschen zu helfen, sie zu heilen, sollte dieses Bewusstsein tief verankert sein. Sollte ich hier dafür angefeindet werden, dass ich nicht so gut laufen kann wie andere, müsste schon etwas gewaltig schieflaufen.
Hatten Sie zuvor Diskriminierung erfahren?
Nur in der Schule, aber das war prägend. Eine sechs Zentimeter hohe Schuherhöhung fällt auf, und Kinder können gemein sein. Da hat man schon ein paar Sprüche einstecken müssen. Als die anderen in der Pubertät anfingen, feiern zu gehen, war ich auf Stützen unterwegs. Nach den OPs musste ich Fixateure tragen, Metallgestelle rund ums Bein. Immer, wenn ich gerade mal weniger eingeschränkt war, zählte für mich vor allen Dingen eines: auf keinen Fall auffallen, so unsichtbar wie möglich durchs Leben gehen – was natürlich nicht funktioniert hat.
Wie sind Sie damit umgegangen?
Irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich mir gedacht habe: Meine Behinderung gehört zu mir, ich kann sie nicht abstellen. Entweder finde ich jetzt einen guten Umgang damit, oder ich verstecke mich mein Leben lang. Ich habe dann für mich entschieden: Ich sage das jetzt, spreche meine Einschränkung offen an! Entweder die Leute akzeptieren mich, wie ich bin, oder sie verschwinden aus meinem Leben. Aber diese Offenheit musste ich erst einmal lernen.
Hatten Sie in diesem Lernprozess Unterstützung?
Zum einen hatte ich meine Eltern, die mich dazu erzogen haben, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Seit ich sechs Jahre alt bin, bin ich außerdem bei den Johannitern aktiv, wo ich heute Kinder und Erwachsene in Erster Hilfe schule. Dort habe ich Rückhalt erfahren. Ich habe mitgemacht, wo ich es konnte. Und im Vereinsgefüge ist es halt so, dass jemand anders übernimmt, wenn du mal eine Pause brauchst.
Haben Sie Ihre Behinderung am BIPS thematisiert?
Als ich dort anfing, damals noch als Studentin, sagte ich direkt ganz offen: Es kann passieren, dass ich wegen meines Beins morgens anrufe und sage, dass ich heute nicht laufen kann. Sie sagten: Macht nichts – wenn du zu Hause an einem Paper feilst, ist das doch auch Arbeitszeit. Sie sagten auch: Wenn du irgendetwas brauchst, gib uns bitte immer Bescheid, wir sehen dann zu, dass du alle Hilfsmittel bekommst. Das ist in meinem Fall zugegebenermaßen nicht viel: ein höhenverstellbarer Schreibtisch, weil ich mit dem kaputten Knie nicht den ganzen Tag sitzen kann, und ein Hocker, auf dem ich zwischendurch die Beine hochlege.

Treffen Sie in Ihrem Alltag auf Barrieren?
Auf dem Weg zur Arbeit habe ich keine Probleme. Ich fahre mit dem Auto zum Bahnhof, dann mit dem Regionalexpress nach Bremen, dort noch einmal mit der Straßenbahn. Es gibt überall Fahrstühle. Und auch das BIPS ist barrierefrei. Es gibt eine Rampe, über die man problemlos ins Haus gelangt, der Fahrstuhl geht über alle Ebenen, jede Ebene für sich ist ebenerdig. Nur auf Kopfsteinpflaster kann ich zum Beispiel nicht laufen, weil es zu uneben ist. Auch Dienstreisen können ein Problem sein: Ich kenne die Wege nicht und muss neben mir selbst Rucksack und Koffer tragen. Und auch in einem Labor könnte ich eher nicht arbeiten.
Warum nicht?
Vor meinem Studium der Gesundheitswissenschaften habe ich eine Ausbildung zur Pharmazeutisch-Technischen Assistentin gemacht, zu der auch ein Praktikum in einer Apotheke zählte. Das heißt: viel Stehen, viel Laufen. Ich habe damals gemerkt, dass das körperlich nicht funktioniert. Auch die Arbeit im Labor ist meist mit viel Stehen verbunden. Man findet natürlich immer einen Weg, aber im Büro ist es für mich angenehmer.
Sie befinden sich gerade mitten in der Promotion, in der Karriere von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist das eine mit Unsicherheiten verbundene Phase. Trifft das auf Sie doppelt zu?
Meine Chancen sind nicht schlechter als die anderer Promovierender. Meine Beeinträchtigung macht mich ja nicht als Forscherin aus. Forschen geschieht in meinem Fall im Kopf, und der funktioniert einwandfrei. Letztlich habe ich dadurch, dass ich meine Behinderung gemeldet habe, sogar einige Vorteile.
Was für Vorteile sind das?
Es geht eher um einen Nachteilsausgleich. Man hat zum Beispiel fünf Urlaubstage mehr im Jahr und einen besonderen Kündigungsschutz. Das BIPS hat übrigens auch eine Inklusionsvereinbarung, die zum Beispiel bei Bewerbungen von Menschen mit Behinderung eine Rolle spielt. Bei gleicher Qualifikation werden sie bevorzugt behandelt – mir hat diese Formulierung im Ausschreibungstext bei Bewerbungen immer Mut gemacht. Im Auswahlverfahren ist dann immer auch die Schwerbehindertenvertretung dabei.
Sind Sie in Kontakt mit anderen Forschenden mit Behinderung?
Ich weiß, dass es weitere Betroffene am Institut gibt, und tausche mich bei Bedarf mit der Schwerbehindertenvertretung des BIPS aus. Das sind eine Kollegin und ein Kollege, die selbst beeinträchtigt sind. An sie kann ich mich jederzeit wenden, und sie haben mir zum Beispiel mit meinem höhenverstellbaren Schreibtisch geholfen. Auch zu diesem Interview haben sie mich ermutigt. Über sie bin ich auch in Kontakt mit der Leibniz-Gemeinschaft gekommen.

Worum ging es bei dem Austausch?
Um die Situation Promovierender mit Behinderung, ein Thema, dem sich die Leibniz-Gemeinschaft verstärkt widmen will. In einer Mail hatte sie zum Austausch eingeladen, neben der Leibniz-Generalsekretärin war auch das Netzwerk der Schwerbehindertenvertretungen der Institute dabei, außerdem ein weiterer Promovierender. Die Frage war, wie die Situation Promovierender mit Behinderung eigentlich aussieht – und wie man mehr Promovierenden mit Behinderung den Weg an die Institute öffnen kann. Eine interne Umfrage zeigte nämlich, dass von den 4.500 Promovierenden bei Leibniz nur sehr wenige eine Behinderung haben. Solche Zahlen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen: Nicht jeder legt seine Behinderung am Arbeitsplatz schließlich offen.
Woran liegt das?
Für manche spielt ihre Schwerbehinderung schlicht keine Rolle, andere behalten sie vielleicht aus Sorge vor Diskriminierung für sich. Der andere Promovierende sagte beim Austausch mit Leibniz, dass es sich jedes Mal, wenn er jemandem von seiner Behinderung erzählt, wie ein kleines Outing anfühlt. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Und irgendwie hat er Recht: Eine Behinderung kann halt auch stigmatisieren. Mich hält das aber nicht davon ab, davon zu erzählen. Ich finde es wichtig, damit die Gesellschaft offener wird. Aber jede Behinderung ist anders, jede und jeder geht anders damit um. Wenn jemand das nicht preisgeben möchte, ist das so und man muss es akzeptieren.
Was würden Sie der Schülerin Christina Princk aus heutiger Sicht empfehlen?
Ich würde ihr raten, zu ihrer Behinderung zu stehen, sie zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen. Heute kommt mir das selbstverständlich vor, aber ich musste erst lernen, dass man trotz Behinderung etwas werden kann. Ich glaube auch, dass meine Behinderung mich als Forscherin beeinflusst hat. Dadurch, dass ich selbst so oft zu Gast im Gesundheitswesen war, sind die anonymisierten Patienten aus unserer Datenbank für mich mehr als namenlose Datensätze.
Profitieren davon auch Ihre Kolleginnen und Kollegen?
Ich glaube, dass diverse Teams generell besser arbeiten. Wenn ich in einem Team zehn Leute habe, die die gleiche Ausbildung absolviert und einen ähnlichen gesellschaftlichen Hintergrund haben, fehlen andere Eindrücke, die man in diversen Teams abrufen kann. Aber manchmal braucht man halt genau diese individuellen Erfahrungen und Sichtweisen.
Welche Ziele haben Sie sich für die kommenden Jahre gesetzt?
Zunächst möchte ich die drei Paper schreiben und veröffentlichen, die zentraler Bestandteil meiner Doktorarbeit sind, um später dann auch den Doktortitel führen zu dürfen. Dann würde ich gerne am BIPS bleiben. Ich habe für mich auch festgestellt, dass ich nicht zwingend Fachgruppen- oder Abteilungsleiterin werden muss, sondern lieber weiter ganz praktisch forschen will. Ich bin also schon da, wo ich hinwollte.
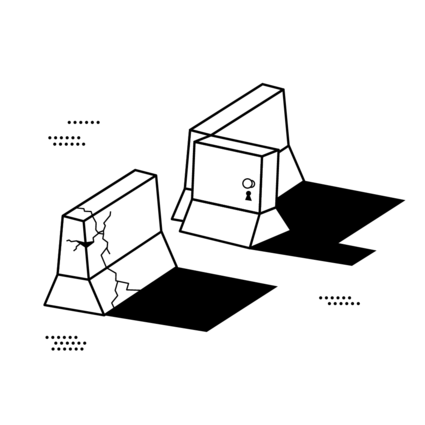
WEG MIT DEN BARRIEREN!
Alle Menschen sollen ihr Leben selbstbestimmt führen können. Doch auch wenn das für Deutschland im Behindertengleichstellungsgesetz schwarz auf weiß festgeschrieben ist, gilt es in der Realität noch viele Barrieren abzubauen. Nicht nur Gebäude, Arbeitsstätten oder öffentliche Verkehrsmittel müssen über Rampen oder Aufzüge zugänglich werden – auch Sprache kann eine Hürde darstellen. Behörden und Medien sollten Formulare und Nachrichten deshalb auch in leichter Sprache verfassen, Webseiten für blinde Menschen hör- und sprachsteuerbar sein. Für Gehörlose sollten Videos untertitelt und Vorträge in Gebärdensprache übersetzt werden – so wie es zum Beispiel der Bundestag bei wichtigen Plenardebatten macht. Barrierefreiheit nützt dabei allen: Eltern, die mit dem Kinderwagen in den dritten Stock wollen, aber auch Menschen, die im Laufe ihres Lebens selbst einmal Unterstützung benötigen.



