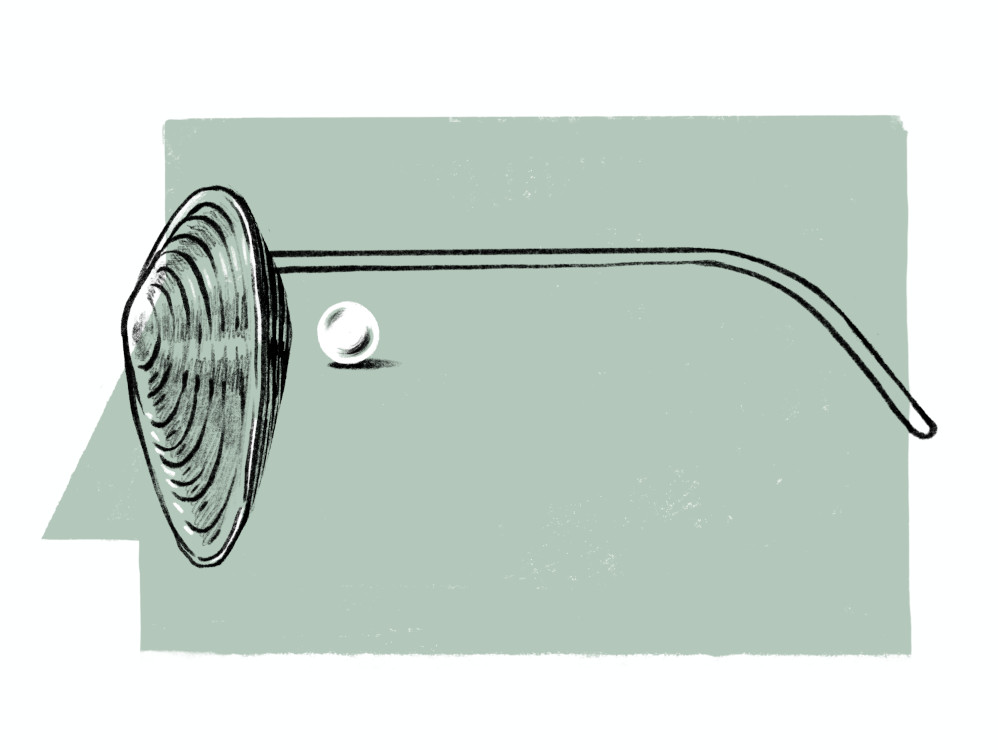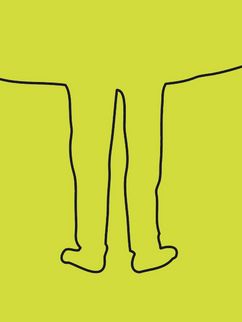Als ich zum ersten Mal eine Perlfigur gesehen habe, ahnte ich noch nicht, dass ich darüber eine ganze Doktorarbeit schreiben würde. Ich war zu Besuch bei Freunden in Dresden und hatte Lust, mir das Schatzkammermuseum, das Grüne Gewölbe, anzuschauen. Dort habe ich die Figuren dann gesehen und fand sie so spannend und so irritierend, dass ich unbedingt mehr darüber wissen musste. 57 Perlfiguren sind im Grünen Gewölbe ausgestellt, die meisten kaum größer als zehn Zentimeter.
Das Irritierende an ihnen ist: Sie stellen sehr häufig Menschen dar, die man heute als körperbehindert bezeichnen würde. Zum Beispiel Bettler mit Beinamputationen, Blinde oder Kleinwüchsige. Menschen, deren Körper von den damals wie heute verbreiteten Vorstellungen von Normalität abweichen. Eine weitere Gruppe, die in den Perlfiguren dargestellt wird, sind Menschen mit dunkler Hautfarbe.
Den Rumpf der Figürchen bildet meist eine kastaniengroße, unregelmäßige Perle. An ihr sind der kleine Kopf, kleine Arme und Beine aus Gold, Emaille, Silber und Diamanten befestigt, die die Figuren zum Funkeln bringen. Deutsche Fürstinnen und Fürsten ließen die Figuren in der Frühen Neuzeit anfertigen, insbesondere zwischen 1695 und 1735, um sie auf Tischen und Konsolen in den fürstlichen Sammlungen zu präsentieren.
Warum ließ sich ein Fürst im 18. Jahrhundert aus kostbarstem Material Körper modellieren, die zur damaligen Zeit als nicht ideal wahrgenommen wurden? Was ist der Sinn dahinter? Was sagt das aus über die Wahrnehmung von Körperbehinderung und über das Körperverständnis in dieser Zeit? Um mehr zu erfahren, versuchte ich Literatur zu den Perlfiguren zu finden und stellte fest: Es gibt keine. Dann muss ich das Buch eben selber schreiben, dachte ich.
Die Perlfiguren haben eine sehr negative, diskriminierende und rassistische Note.
VERENA SUCHY

Und so war mein Dissertationsthema geboren. Die Fragen, die mir im Museum durch den Kopf schossen, wurden zu zentralen Fragen meiner Arbeit. Damals, im Grünen Gewölbe, wusste ich noch nicht, wie vielschichtig und komplex die Antworten sein würden. In der Frühen Neuzeit verknüpften die Menschen bestimmte Bedeutungen mit Naturgegenständen. Die Perle in der Muschel symbolisierte den Fötus im Mutterleib. Man setzte sie dem menschlichen Körper gleich. Nun sind nicht alle Perlen rund und glatt. Es gibt extrem große, verwachsene und deformierte Perlen, sogenannte Barockperlen. In der damaligen Deutung bildeten sie das Besondere, die Vielfalt der Schöpfung ab. So wird auch verständlich, warum diese besonderen Perlen von Juwelieren in »besondere« menschliche Körper transformiert wurden.
Das hat natürlich eine sehr negative, diskriminierende und rassistische Note und erinnert an Völkerschauen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Auf diesen »Freak Shows« wurden dieselben Personengruppen zur Schau gestellt, die auch in den Perlfiguren zu sehen sind. Sie wurden verspottet und angestarrt. Ähnlich verhält es sich nun mit den Figuren im Museum. Wahrscheinlich machen sich die meisten von uns heute nicht mehr über sie lustig – trotzdem starren wir sie an, weil sie so anders sind. Für die Fürstinnen und Fürsten bedeutete es einerseits Prestige: Sie konnten durch die dekorativen Figuren zeigen, dass sie all die symbolischen Deutungsebenen verstehen. Andererseits wollten sie sich von ihren »marginalisierten« Untertanen absetzen.
Die Forschung zeigt ganz klar, dass Behinderung eine kulturelle Kategorie und nicht naturgegeben ist. Im Gegenteil, sie ist je nach Zeit und kulturellem Hintergrund variabel. Ganz deutlich wird es an mir selbst: Ich trage eine Brille. Heutzutage gelte ich weder als behindert noch falle ich in der Öffentlichkeit auf. Um 1700 wäre das mit meiner Sehschwäche definitiv anders gewesen. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass ich sie mit einer Brille mittlerweile gut ausgleichen kann, sondern auch damit, dass das, was körperlich als normal oder unnormal gilt, nicht in Stein gemeißelt ist. Es wandelt sich mit der Zeit. Was wir im Jahr 2022 als Behinderung wahrnehmen, könnte also in zehn Jahren gar nicht mehr als unnormal gesehen werden.
»DJS trifft Leibniz«
Der Text über Verena Suchys Forschung ist im Rahmen des Workshopformats »DJS trifft Leibniz« entstanden, das wir seit Anfang 2021 regelmäßig mit der Deutschen Journalistenschule organisieren. Die Idee ist einfach: 15 Journalistenschülerinnen und -schüler – eine Klasse der DJS – treffen auf 15 junge Forschende von Leibniz-Instituten. Gemeinsam üben sie Interviewsituationen: Wie bereitet man ein Interview mit einer Wissenschaftlerin vor? Wie erzählt man Journalisten so von seiner Forschung, dass keine Missverständnisse entstehen? Wie tickt die jeweils andere Seite? Außerdem diskutieren sie mit renommierten Wissenschaftlerinnen und werten die Interviews mit erfahrenen Wissenschaftsjournalisten aus. Am Ende landen die Texte in unserem Onlinemagazin – wo ihr sie ab sofort regelmäßig in der Rubrik »Die Welt in 10 Jahren« lesen könnt.
Und das zeigt – damals wie heute – das Potenzial von Kunst. Sie hat immer wieder den Anspruch zu irritieren und Sehgewohnheiten auf den Kopf zu stellen: In welcher sozialen Position befindest du dich durch deine Körperlichkeit? Könnte es nicht auch ganz anders sein? Kunst spielt mit dem Selbstverständnis der Menschen und bringt dieses ins Wanken. Die Perlfiguren dürften bei Fürsten eine gewisse Angst ausgelöst haben, da sie die eigene körperliche Unversehrtheit in Frage stellten. Zu realisieren, es sind ja gar nicht alle wie ich! Es gibt die Anderen
, bedroht die eigene Position oder macht sie prekär. Körperliche Unversehrtheit ist keine Gewissheit, auf die man sich immer verlassen kann. Doch erst, wenn wir ein inklusiveres Verständnis davon entwickeln, was ein »normaler Körper« ist, können wir die diskriminierende Unterscheidung zwischen »normalen« und »anderen« Körpern überwinden und Ängste gegenüber körperlicher Versehrtheit und Behinderung abbauen.
VERENA SUCHY
ist Wissenschaftliche Volontärin am Germanischen Nationalmuseum. An dem Leibniz-Forschungsmuseum für Kulturgeschichte forscht die Kunsthistorikerin und Ethnologin in der Sammlung »Kunsthandwerk bis 1800 und Handwerksgeschichte«.