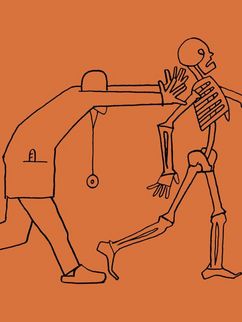Er hat sie auf Leichtstoffplatten aufziehen lassen, die im Licht der Halogenlampen glänzen. Kante an Kante hängen sie da, die mehr als 45 Cover der Fachzeitschriften, die seine Studienergebnisse als Titelgeschichte veröffentlicht haben. Sie füllen fast eine ganze Wand in Oliver G. Schmidts Büro. Schmidts persönliche Wall of Fame.
Im März kam eine weitere Auszeichnung hinzu. Dem Dresdener Nanowissenschaftler wurde der Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis verliehen, die höchste Auszeichnung für einen Wissenschaftler in Deutschland. 2,5 Millionen Euro erhält Schmidt für seine Forschung am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (IFW). Hier entwickeln er und seine rund 80-köpfige Forschungsgruppe unter anderem Mikromotoren, die gerade einmal wenige tausendstel Millimeter groß sind und sich von alleine fortbewegen. »Sie bestehen oft aus hauchdünnen Schichten, die sich selbstständig zu dreidimensionalen Strukturen aufrollen«, sagt Schmidt. »Hier ist ein Bild davon.« Obwohl er über einsneunzig groß ist, muss er sich strecken, um das richtige Cover anzutippen.
Die Bilder an der Wand zeichnen weit mehr als Schmidts persönliche Erfolgsgeschichte nach. Sie zeigen auch, dass der 46-Jährige ein Getriebener ist, immer auf der Suche nach neuen Forschungsthemen. Er hat in Kiel, London und Berlin studiert. Forschte in Kalifornien, Tokio und am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart. 2007 kam er nach Sachsen. Seither ist er Professor an der Technischen Universität Chemnitz und leitet das Institut für Integrative Nanowissenschaften am IFW in Dresden. Die meisten seiner Veröffentlichungen hat er hier publiziert. Und hier wurde er 2016 zum Vater der »Spermbots«.
In einer Petrischale stattete Schmidt Rinderspermien mit spiralförmigen Mikromotoren aus und steuerte die »Spermienroboter« mithilfe eines Magnetfeldes zur Eizelle. Lahme Spermien, die Anschub von kleinen Robotern bekommen? Die Presse lief Sturm, Schmidt machte weltweit Schlagzeilen. Ob seine Ergebnisse auch für menschliche Samenzellen gelten, werden aber andere untersuchen. Das strenge Embryonenschutzgesetz in Deutschland untersagt die Befruchtung menschlicher Eizellen zu Forschungszwecken. Schmidt bleibt die Forschung mit tierischen Spermien. »Manchmal reicht es schon aus, ein Feld aufzumachen, das dann andere weiterbeackern«, sagt er.
Für seinen Ansatz macht sich Schmidt den natürlichen Drang der Spermien zunutze.

Schmidt mag diese Rolle des Pioniers. 2010 stellte er den Guinness-Weltrekord für den kleinsten von Hand hergestellten Düsenantrieb auf. Das Zertifikat hängt noch eingerahmt hinter seinem Schreibtisch, auch wenn ihm inzwischen ein ehemaliger Mitarbeiter seiner Gruppe den Rekord abgejagt hat. »Wenigstens bleibt er in der Familie.« Den aktuellen Rekord will Schmidt nicht unterbieten — obwohl er es schaffen könnte, wie er sagt.
Stattdessen konzentriert er sich auf ein anderes Thema. Dieses Mal sollen nicht die Spermien transportiert werden, sie sollen zu Transportern werden. »Samenzellen lassen sich wunderbar mit Medikamenten beladen und werden vom weiblichen Körper nicht abgestoßen«, sagt Schmidt. »Ideale Voraussetzungen, um gynäkologische Krebsarten zu bekämpfen.«
Für seinen Ansatz macht sich Schmidt den natürlichen Drang der Spermien zunutze: Sie sind dafür gemacht, mit Zellen zu verschmelzen und bewegen sich selbstständig vorwärts. Schmidt muss die präparierten Spermien nur noch mit einem magnetischen »Anzug« austatten, um sie dann gezielt zur Krebszelle zu lenken.
Nachdem erste Labortests geglückt sind, haben Schmidt und seine Kollegen im Januar die Ergebnisse veröffentlicht. Wieder wurde Schmidt mit Presseanfragen bombardiert. Sie zu beantworten, ist mittlerweile Routine für ihn. Wenn er von Wirkstoffdosen, Spermienzahlen und Steuerungsmechanismen spricht, klingt alles so simpel, so optimistisch — so machbar.
Doch wer Schmidt dann fragt, wann seine Spermienroboter denn nun Menschen von Krebs heilen werden, erntet lautes Lachen. »Wir reden hier immer noch von Grundlagenforschung, der Weg zur Anwendung ist lang. Manchmal reicht ein einziger Mensch, um ihn zu begehen. Aber wenn man ausgerechnet diesen nicht findet, kann eine ganze Vision scheitern.«
Noch vor etwas mehr als 15 Jahren sahen manche Schmidts gesamte Disziplin kurz vor dem Scheitern. Die Fachwelt diskutierte, ob die Nanowissenschaften eine Zukunft hätten; man konnte sich nicht vorstellen, dass Mikroroboter die Ärzte von morgen sein sollten. Aus einer Schublade seines Schreibtischs kramt er eine Bild-Zeitung aus dem Jahr 2008 hervor. »Kleinste Rakete der Welt soll Krebszellen beschießen!« Daneben zeigt ein Foto den jungen Schmidt im Labor.
»Als das erschienen ist, habe ich mich schrecklich gefühlt«, sagt er. »Damals standen wir noch ganz am Anfang. Wenn dann so etwas erscheint, sagt die wissenschaftliche Community: ›Was ist das denn für ein Mist, mit Raketen kann man niemals Krebs bekämpfen‹.«
Heute zeigt Schmidt den Artikel feixend in Vorträgen. Sie seien jetzt schon ein ganzes Stück weiter als noch vor zehn Jahren. Und vom Scheitern der Nanowissenschaften spricht keiner mehr. An der TU Chemnitz wird derzeit sogar ein neuer Forschungsbau errichtet, das Zentrum für Materialien, Architekturen und Integration von Nanomembranen. Schmidt hat das interdisziplinäre Projekt vor mehr als fünf Jahren initiiert, mehrere Fakultäten sind beteiligt.
Mit den Jahren hat sich sein Arbeitsschwerpunkt verschoben. Schmidts Alltag heute: Projektmittel beantragen, Vorlesungen halten, Personal managen. Als bekannt wurde, dass der Mann mit den Spermienrobotern den Leibniz-Preis erhält, wollten ihn die Pressefotografen trotzdem ins Labor stellen. Schmidt lehnte dankend ab. »Früher war ich ständig im Labor, jetzt ist das selten geworden. Ich würde die Leute wahrscheinlich eher stören.« Mit seinen Mitarbeitern bespricht er stattdessen, welche Projekte sie als nächstes angehen und wie sie Probleme bei Labortests lösen können. »Ich bin jetzt Ideengeber.«