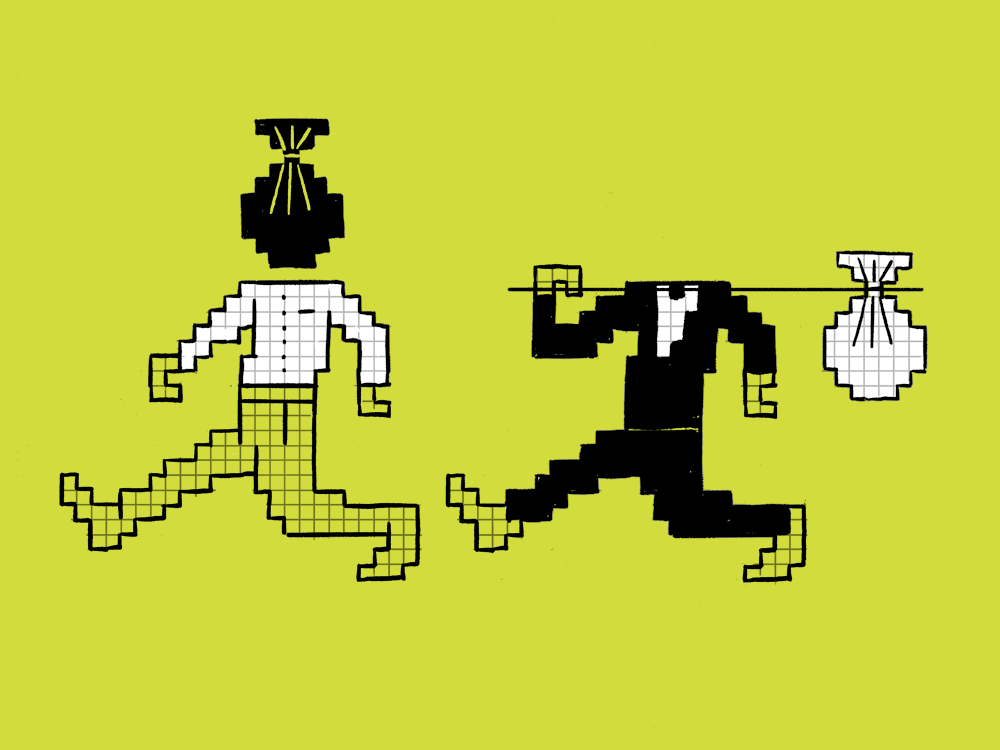Denken Sie sich eine Zahl. Irgendeine. Gut, positiv sollte sie sein und keine Kommazahl. Haben Sie eine? Wunderbar. Falls Ihre Zahl gerade ist, teilen Sie sie durch Zwei. Ist sie ungerade, verdreifachen Sie die Zahl und addieren Eins. In jedem Fall sollten Sie nun eine neue Zahl haben, mit der Sie genau so fortfahren: Wenn gerade, dann durch Zwei, wenn ungerade, dann mal Drei und plus Eins. Das Ergebnis ist eine auf- und absteigende Folge von Zahlen, die in etwa so aussieht:
7->22->11->34->17->52->26->13->40->20->10->5->16->8->4->2->1->4->2->1 …
Sind Sie mit Ihrer Zahl auch in einem 4-2-1-Zyklus hängengeblieben? Das kann vielleicht daran liegen, dass die Zahl, die Sie gewählt haben, kleiner ist als 200 Trillionen. Denn für alle derartigen Zahlen hat man nachgerechnet, dass sie sich, wenn man obige Rechenanweisung befolgt, irgendwann bei 4,2,1 festsetzen. Natürlich heißt das noch lange nicht, dass dies für alle Zahlen richtig sein muss, es gibt schließlich unendlich viele Zahlen. Man vermutet aber, dass jede Zahl diese Eigenschaft hat, und bisher hat auch noch niemand einen anderen Zyklus gefunden, oder eine Folge, die in gar keinen Zyklus mündet.
Die Collatz-Vermutung, benannt nach dem deutschen Mathematiker Lothar Collatz, der dieses Problem in den 1950er Jahren als erster untersuchte, gilt als eines der hartnäckigsten offenen mathematischen Probleme überhaupt. Weltweit haben Generationen von Mathematikerinnen und Mathematiker nach einem Beweis oder einem Gegenbeispiel gesucht – bis heute vergeblich.
Aber es ist nicht nur Ruhm und weltweite Anerkennung, die zu einer Lösung des Problems motivieren können: Wer in der Lage ist, die Collatz-Vermutung zu beweisen (oder zu widerlegen), dem winken nicht weniger als 120 Millionen Yen, rund 800.000 Euro. Gestiftet wurde die Summe von dem japanischen Softwareunternehmen Bakuage, das den Preis 2021 ausgeschrieben hat.
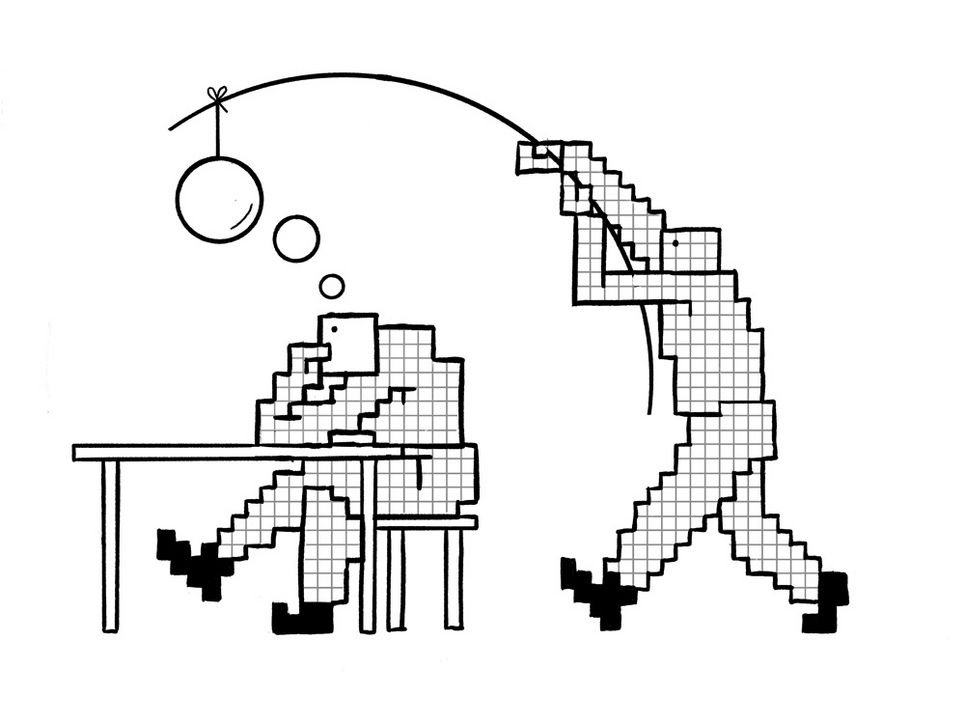
Derartige Preisgelder sind in der Mathematik keine Seltenheit. Neben anderen Preisen – eine Million US-Dollar für einen Beweis der Beal-Vermutung, einer Vermutung aus der Zahlentheorie, oder 250.000 Dollar für das Finden einer Primzahl mit mehr als einer Milliarden Dezimalstellen – sind die sieben Millennium-Probleme, ausgerufen vom Clay-Institute for Mathematics und mit je einer Million Dollar dotiert, die wohl bekanntesten.
Doch eignet sich Geld überhaupt als Motivator für mathematische Forschung? Das denke ich nicht
, sagt Gerhard Huisken, Direktor des Mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach, einem idyllisch im Schwarzwald gelegenen Leibniz-Institut. Jedenfalls nicht für Leute, die tatsächlich an diesen Problemen arbeiten. Selbst Laien, die behaupten, sie hätten eines der großen Probleme gelöst, geht es fast immer eher ums Rechthaben, und so gut wie nie um das Geld
. Huisken ergänzt: Aber zur Popularisierung der Mathematik leisten sie sicherlich einen Beitrag. Selbst wenn es zu Animositäten, etwa in Urheberfragen, kommt: Besser hin und wieder ein Streit als überhaupt nicht im Gespräch sein.
Ein Blick in die Mathematikgeschichte offenbart, dass die Kultur der Preisgelder auf eine lange Tradition zurückblicken kann. In der Renaissance duellierten sich Mathematiker wie Niccolo Tartaglia, Gerolamo Cardano und Scipione del Ferro auf öffentlichen Plätzen, indem sie sich gegenseitig Aufgaben stellten. Die Anerkennung der Gelehrtengemeinschaft spielte dabei nur eine untergeordnete Rolle, der Hauptaspekt dieser Wettstreite war stets der schnöde Mammon. So verwundert es wenig, dass eine der bedeutendsten Entdeckungen der Renaissancemathematik, die Lösungsformel für Gleichungen dritten Grades (also Gleichungen der Form x^3+ax^2+bx^3+c=0), lange Zeit geheim blieb – eine Veröffentlichung hätte ihrem Entdecker Tartaglia beim Knobeln um Geld einen Wettbewerbsnachteil bedeutet.
Einer der ältesten verbrieften hochdotierten Preisausschreiben für offene Probleme geht auf den norwegisch-schwedischen König Oskar II. zurück, der 1889 zu seinem 60. Geburtstag eine Belohnung von 2.500 Kronen – heute in etwa 50.000 Euro – auf die Lösung des Drei-Körper-Problems ausrief.
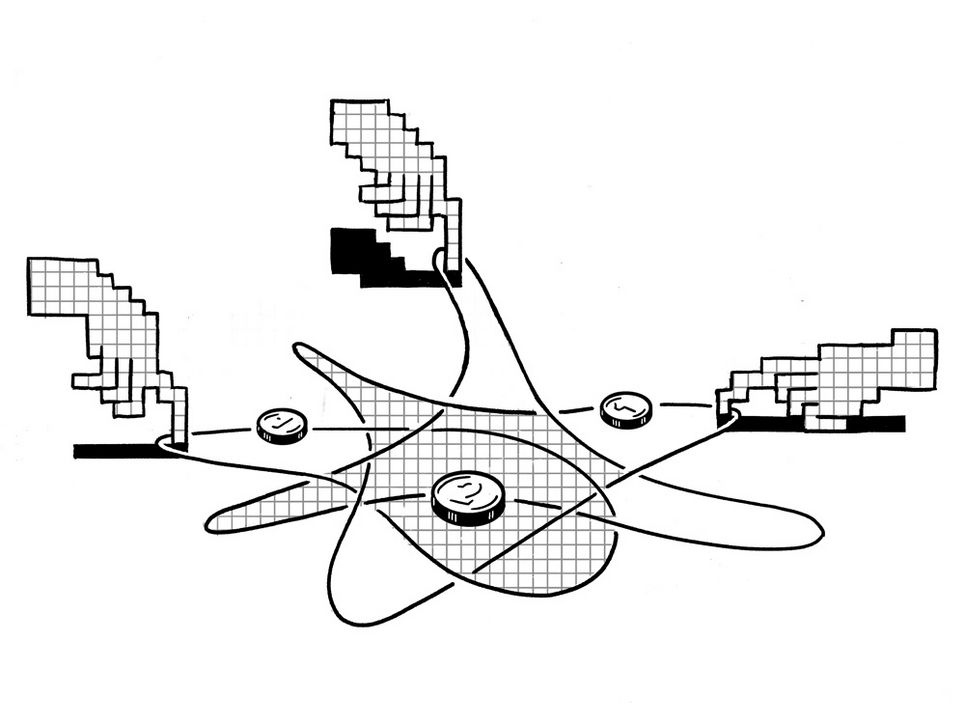
Bei dem Problem geht es um die Frage, wie sich ein System aus drei Objekten unter Einfluss der Gravitation verhalten wird. Für zwei Körper, beispielsweise die Sonne und die Erde, ist das Problem vergleichsweise einfach: Nach den Keplerschen Gesetzen, die wiederum aus dem Newtonschen Gravitationsgesetz folgen, drehen sich die beiden Körper in elliptischen Bahnen um den gemeinsamen Schwerpunkt. Sind allerdings drei Körper im Spiel, weisen die Bahnen ein ausgesprochen chaotisches Verhalten auf, das die damalige Mathematik vor unlösbare Schwierigkeiten stellte. Eingestrichen hat das Preisgeld Henri Poincaré, der das Problem zwar nicht lösen, aber bedeutende Fortschritte auf dem Gebiet erzielen konnte. Unter anderem war es Poincaré, der herausgearbeitet hat, dass selbst kleinste Änderungen in den Anfangsbedingungen eines Drei-Körper-Systems zu erheblichen Änderungen im weiteren Verlauf führen können – dies war die Geburtsstunde der Chaostheorie, mit der heute Wetterereignisse, Börsenkurven und Herzinfarkte erklärt und modelliert werden können.
Auch im kleinen, privaten Rahmen wurde die Tradition der Preisgelder fortgesetzt. Die Mathematiker der Lemberger Schule zum Beispiel, die in den 1930er Jahren im damals polnischen Lemberg (heute Lviv, Ukraine) wirkten, waren bekannt für ihre mathematischen Preisausschreiben. Die Gruppe um Stefan Banach, Stanislaw Ulam und Stanislaw Mazur, die mit der Einführung der Funktionalanalysis unter anderem das mathematische Fundament der Quantenmechanik legten, hatten ihre ganz eigene Handhabe, mit Preisen die Motivation anzukurbeln. Sie trafen sich meist im Schottischen Café, einem Wirtshaus unweit der Universität, wo sie, teils bis spät in die Nacht, mathematische Probleme diskutierten. Ein ständiger Begleiter der Runden war das nach dem Wirtshaus benannte »Schottische Buch«, eine Kladde, die Ulams Frau für die Runde besorgt hatte, angeblich weil es zu Beschwerden über bekritzelte Tischdecken und Servietten seitens der Bewirtung gekommen war.
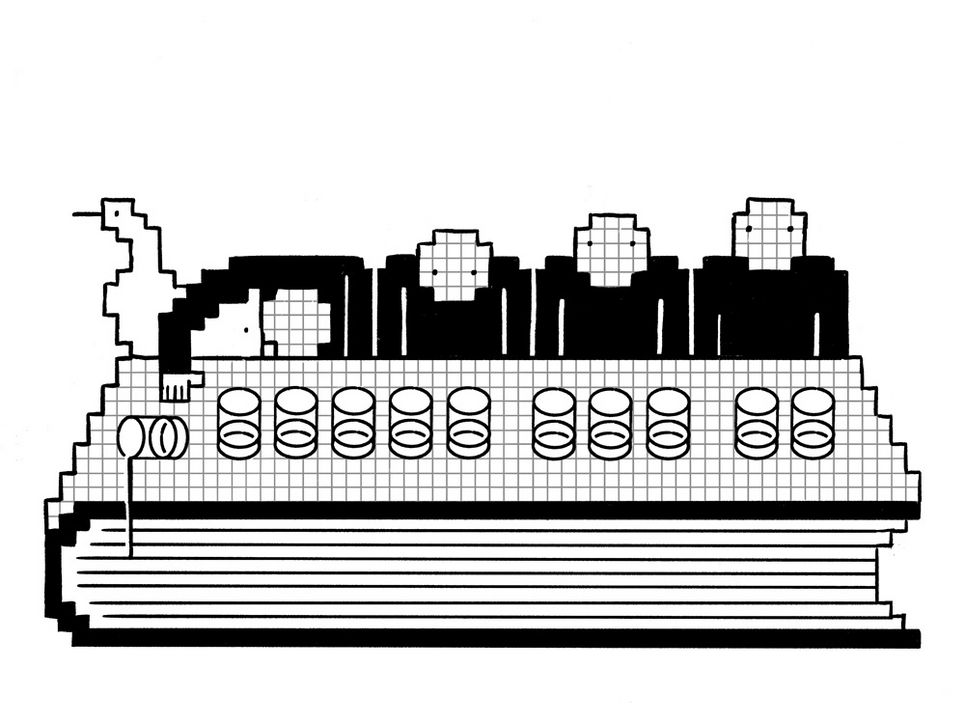
Festgehalten wurden im schottischen Buch vor allem offene Probleme, über die sich die polnischen Mathematiker die Köpfe zerbrachen. Und schon bald wurden auf die niedergeschriebenen Fragen Preise ausgeschrieben. Neben diverser, hochpreisiger und -prozentiger Alkoholika wurden auch andere kostbare Güter verwettet: 100 Gramm Kaviar für denjenigen, der Problem 152 lösen konnte, ein Kilogramm Speck für Problem 184, eine Frage aus der Theorie der partiellen Differentialgleichungen. Für Problem 153, ein Problem aus der Approximationstheorie, lobte Stanislaw Mazur sogar eine lebende Gans aus. Es dauerte nicht weniger als 37 Jahre, bis der Schwede Per Enflo, der zu Zeiten der Lemberger Schule noch nicht geboren war, 1972 für die Lösung seinen gefiederten Preis in Warschau entgegennehmen durfte – natürlich überreicht von Mazur selbst.
Legendär waren auch die Wetteinsätze von Paul Erdös, dem berühmten ungarischen Mathematiker. Erdös war ein eigensinniger Mensch; er hatte den Großteil seiner mathematischen Laufbahn keinen festen Wohnsitz, sondern reiste mit einem kleinen Koffer, in dem er seine Habseligkeiten bewahrte, um die Welt, um Kollegen zu treffen und Vorträge zu halten. Einen Lehrstuhl hatte er nie inne. In seinen Vorträgen machte Erdös es sich zur Gewohnheit, Gelder auf zahlentheoretische Probleme auszusetzen.
Ich habe ihn mal Ende der Achtziger auf einer Konferenz in Australien kennengelernt, als ich Post-Doktorand an der Australian National University in Canberra war
, sagt Huisken. Er war sehr freundlich. Ich musste ihn vom Bahnhof abholen, da hatte er seinen berühmten Koffer dabei; und bei der Rückfahrt war seine größte Sorge, dass ich mich verfahre. Richtig aufgeblüht ist er in den Vorträgen. Dort streute er auch zwischenzeitlich ein, dieses sei ein 50-Dollar-Problem, jenes ein 100-Dollar-Problem.
Obwohl Erdös, wie Huisken erklärt, seine Wetteinsätze eher als Stilmittel denn als tatsächliche Wetten verstand, um nicht fortwährend komplex, komplexer, am komplexesten für die Beschreibung der Probleme zu benutzen
, kam er dennoch in der Regel der Auszahlung der Wetteinsätze nach. Den ersten Preis, 1.000 US-Dollar für ein Problem aus der Theorie der arithmetischen Folgen, erhielt 1974 der ebenfalls aus Ungarn stammende Endre Szemerédi, der später für ebendieses Resultat mit der Fields-Medaille, einer der höchsten mathematischen Auszeichnungen, geehrt wurde. Auch nach Erdös Tod wurden die zahllosen Geldpreise, die er zeitlebens aussprach, eingelöst – verantwortet durch Erdös langjährigen Freund und Wegbegleiter Ronald Graham. 2014 wurde der bislang höchstdotierte Erdös-Preis ausgezahlt, die Mathematiker Terrence Tao, Kevin Ford, Ben Green und Sergei Konyagin teilten sich 10.000 US-Dollar für die Lösung eines 70 Jahre alten Problems über die Länge von Lücken zwischen aufeinanderfolgenden Primzahlen.
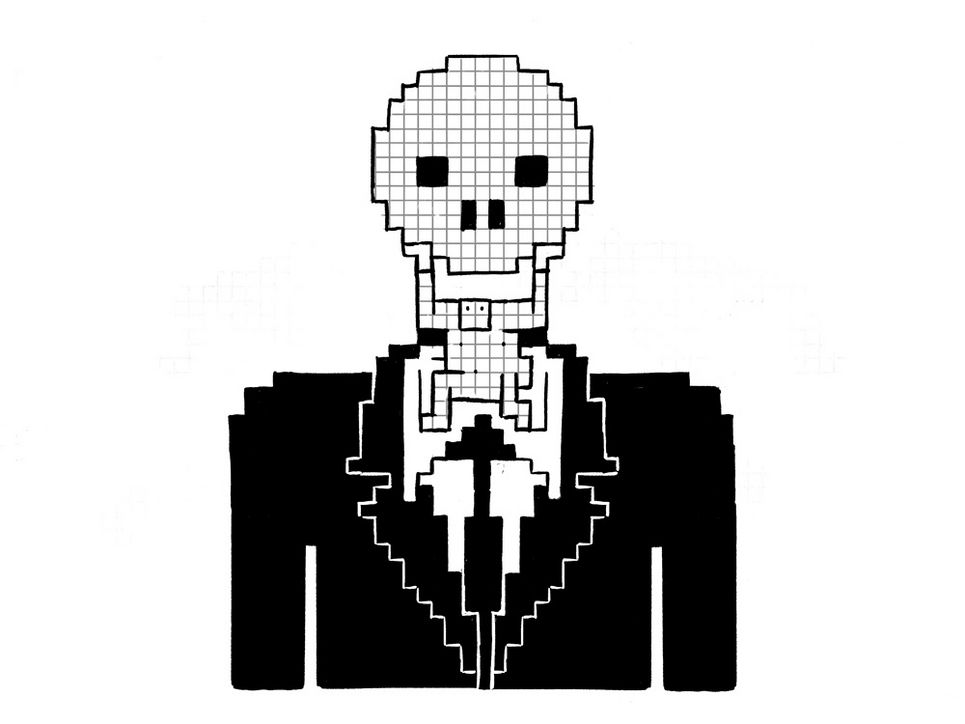
Die moderne Mathematik hat, wie man an den sieben Millionen Dollar der Clay-Stiftung erahnen kann, einen weniger bescheidenen Umgang mit der Auslobung von Preisgeldern. Und nur eines der Millennium-Probleme, die Poincaré-Vermutung, konnte bislang gelöst werden. Grob gesprochen handelt die Poincaré-Vermutung von der Frage, ob sich ein Objekt beliebiger Dimension, auf dem man immer eine Schlaufe wie ein Gummiband zu einem Punkt zusammenziehen kann, zu einer Kugel entsprechender Dimension deformieren lässt. Als besonders hartnäckig erwies sich dabei der dreidimensionale Fall. Er wurde 2002 von Grigori Perelman gelöst, der die Million US-Dollar, die ihm für die Lösung zustand, jedoch ablehnte – der russische Mathematiker sah die Vorarbeiten seines Kollegen Richard Hamilton nicht ausreichend gewürdigt.
Perelmans Ablehnung schlug auch außerhalb der mathematischen Öffentlichkeit hohe Wellen. Die Meldungen überschlugen sich, es verfestigte sich das Bild eines weltfremden Einzelgängers, eines mathematischen Eremiten. In den Augen von Gerhard Huisken, der Perelman kurz nach der Veröffentlichung seiner Arbeiten auf einem Seminar in Berlin traf, ist diese Darstellung jedoch unhaltbar: Ich habe ihn zusammen mit Kollegen unmittelbar nach dem Erscheinen seiner Arbeit zu einem Seminar in Berlin eingeladen. Perelman ist ein sehr freundlicher, bescheidener Mensch. Er hat sich nach seinem Vortrag viel Zeit für unsere Fragen genommen.
Dass Perelman dem Preis keine Beachtung schenkte, überraschte Huisken wenig. Es ging ihm nie nur um die Poincaré-Vermutung
, so der Direktor des mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach. Perelman ging es vielmehr um die Zusammenhänge, die er mit seiner Forschung darlegen konnte: Massetransport, Entropie, und was das Ganze mit der Wärmeleitungsgleichung zu tun hat – das ist, was ihn eigentlich fasziniert hat.
Dass die Poincaré-Vermutung als eine Art Nebenprodukt dabei heraussprang, sei ihm weniger wichtig gewesen. Und so ist es nur konsequent, dass er den Clay-Preis abgelehnt hat
.