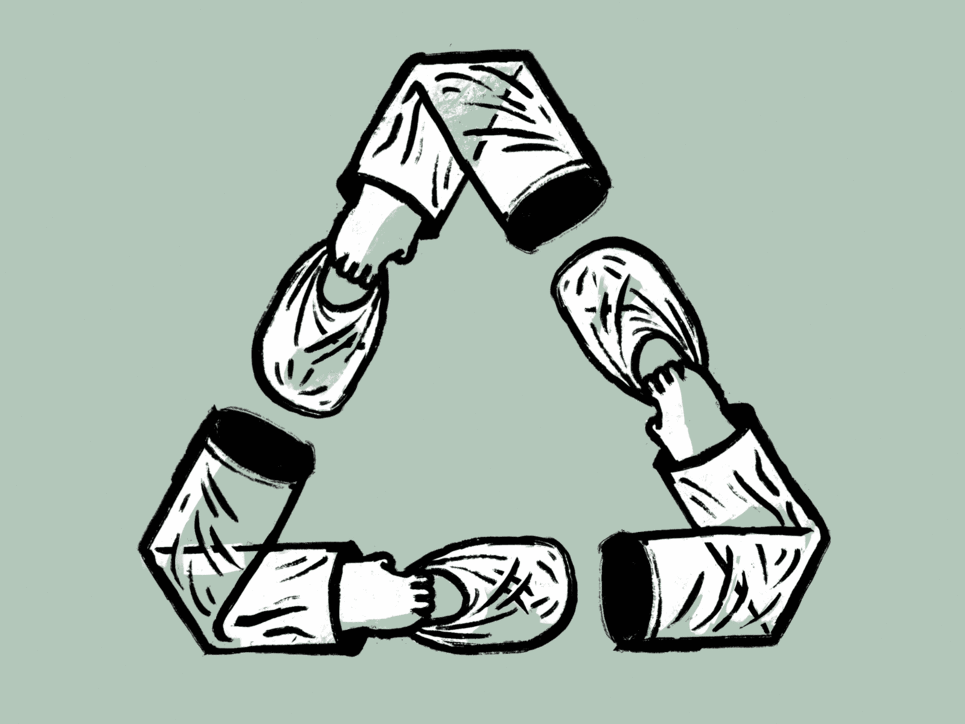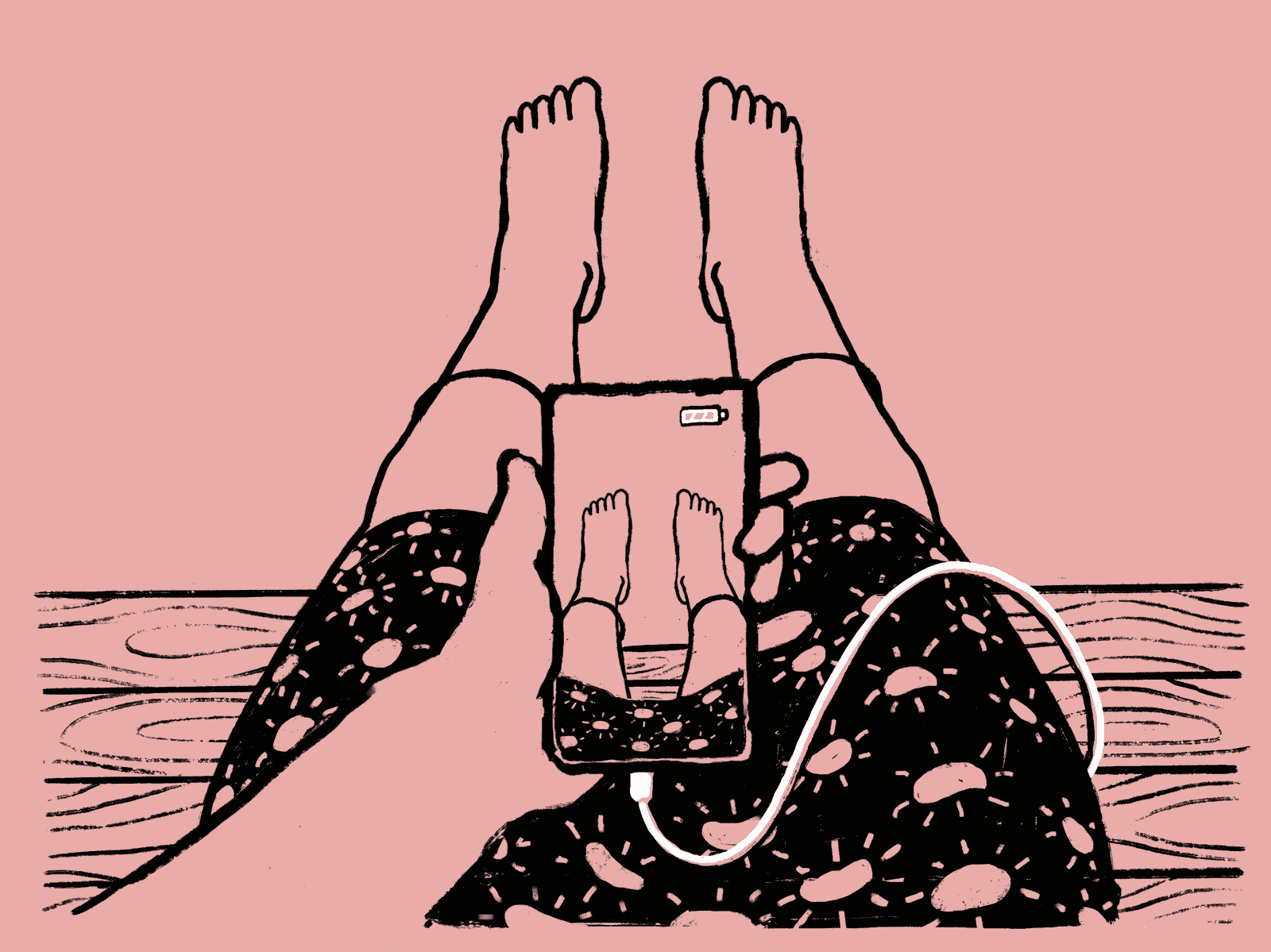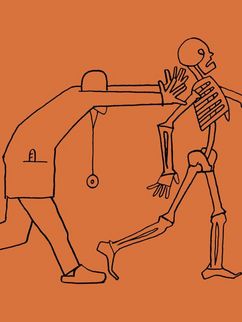Vielfältige Faser
Naturfasern haben eine lange Tradition und spielen bis heute eine wichtige Rolle in den verschiedensten Bereichen – etwa bei der Herstellung von Textilien, Seilen und Baustoffen. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts jedoch machen synthetische Fasern den natürlichen Alleskönnern starke Konkurrenz. T-Shirts aus Polyester und synthetische Dämmstoffe wie Styropor, Mineral- und Glaswolle sind schlicht billiger im Einkauf
, sagt Hans-Jörg Gusovius vom Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie (ATB).
Der Haken: Synthetische Fasern verbrauchen in der Herstellung viel Energie. Sie sind biologisch kaum abbaubar und enden daher häufig als Sondermüll. Und auch ungünstige Materialeigenschaften können zum Problem werden. Ein Beispiel: der Hausbau. Synthetische Fasern in modernen Baukonzepten und in Kombination mit anderen Dämmmaßnahmen können ein Haus so hermetisch abdichten, dass Schimmel entsteht. Man wohnt dann wie in einer Plastiktüte.
Die Vorzüge von Naturfasern haben Mitarbeiter des ATB untersucht. In einer umfangreichen Datensammlung tragen sie derzeit Zahlen und Fakten zu Hanf, Stroh und Co. zusammen. Die Materialeigenschaften natürlicher Dämmstoffe dürften insbesondere für umweltbewusste Architekten, Planer und Eigenheimenthusiasten von Interesse sein. Hanf und Flachs zum Beispiel haben eine hohe Wärmespeicherkapazität. Sie verhindern, dass sich Räume aufheizen und sorgen so für einen enorm guten Wohnklimaeffekt.
Weitere Forschungsarbeiten unter Beteiligung des ATB zeigen die gute Feuchtigkeitsregulation von Brennnesselfasern, die man, so Gusovius, fein, bis hin zur Unterwäschequalität
aufbereiten kann. Aktuell suchen die Wissenschaftler nach Möglichkeiten, Biomasse aus Öllein-Stroh und Hopfenpflanzen zu verarbeiten. Es existiert eine ganze Reihe bislang ungenutzter Rohstoffe in der Natur. Ihr Einsatz könnte zu einer verbesserten Ökobilanz beitragen.

Elektrisierender Sand
Sand! Und Sonne! Was bei Pandemie-geplagten Daheimbleibern Sehnsüchte weckt, steht am Leibniz-Institut für Photonische Technologien (IPHT) in Jena für die Welt von morgen. Denn hier hat die Arbeitsgruppe Photonic Thin Film Systems von Jonathan Plentz ein Solargewebe entwickelt, das als mobile Stromquelle der Zukunft einen Beitrag zur Energiewende leisten könnte. Silizium, der Hauptbestandteil von Sand, ist das Basismaterial der textilen Dünnschichtsolarzellen, die die Forscher in Zusammenarbeit mit Industriepartnern zur Meterware weiterentwickeln wollen.
Das Ziel: die Produktion von Kleidung, Rucksäcken und Zelten, mit denen man unterwegs aus Sonnenlicht Strom erzeugen kann – ganz ohne Stromaggregat oder Powerbank. Unser Solargewebe hat gegenüber klassischen Solarzellen den Vorteil, dass es leicht, flexibel und atmungsaktiv ist und daher zu sogenannten Smart Textiles verarbeitet werden kann
, erklärt der Photovoltaik-Experte. Das Solarzellenschichtsystem wird direkt auf einen Spezialstoff aufgetragen, in den hauchfeine Metalldrähte eingewebt sind.
Dank dieses patentierten Designs kann der Stoff nach Wunsch zurechtgeschnitten und verarbeitet werden, ohne dass das Solargewebe seine Funktion verliert. Während man am Strand in der Sonne liegt, könne man dann zum Beispiel das Handy oder den MP3-Player laden, sagt Jonathan Plentz. Und damit erhebliche Mengen Energie einsparen: 2017 lag der Strombedarf für den Betrieb von Smartphones in der EU bei mehr als einer Milliarde Kilowattstunden. Das entspricht über 160.000 Tonnen Steinkohle.
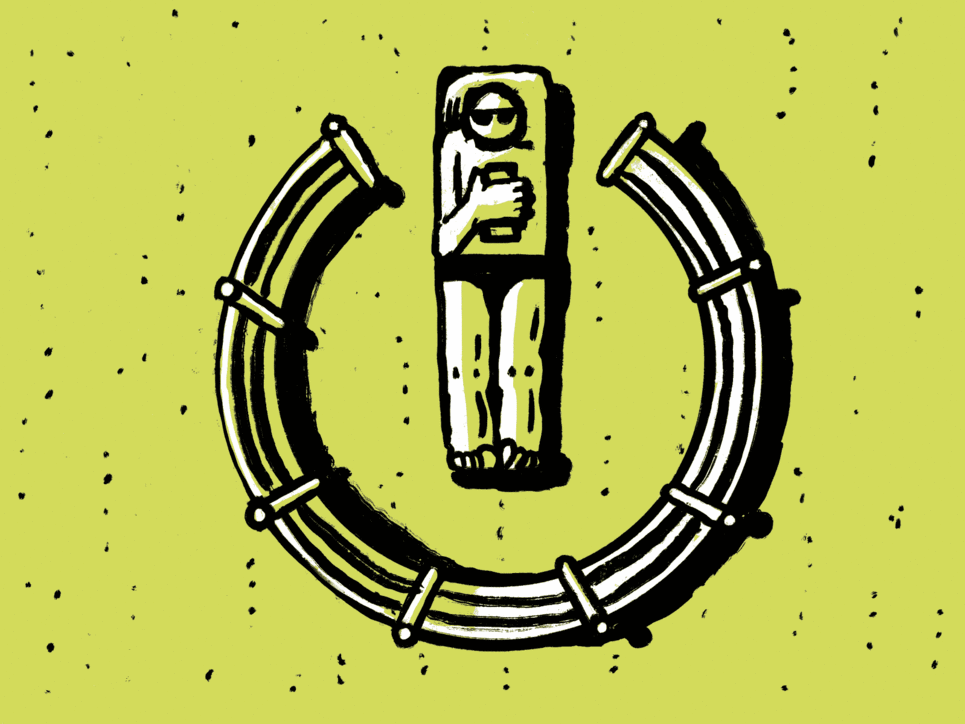
Lebendige Linse
Wenn die Augen erkranken, steht Patienten häufig ein langer Leidensweg bevor. Um die Sehkraft zu bewahren, brauchen sie teure Medikamente, müssen immer wieder zu Augentropfen greifen und schmerzhafte Injektionen über sich ergehen lassen. Um ihre Lage zu verbessern, haben sich am WissenschaftsCampus Living Therapeutic Materials
Biomaterialwissenschaftler vom Leibniz-Institut für Neue Materialien (INM) mit Experten aus Pharmazie und Medizin zusammengetan.
Gemeinsam entwickeln sie ein ungewöhnliches System zur Abgabe von Arzneimitteln: eine lebendige
Kontaktlinse. Bislang werden Spezialmedikamente im Labor von gentechnisch veränderten Bakterien hergestellt, zu Infusionen, Injektionen oder zu Augentropfen weiterverarbeitet und erst dann verabreicht
, sagt Aránzazu del Campo. Diesen Prozess wollen die Wissenschaftliche Geschäftsführerin des INM und ihre Kollegen verschlanken – und die Behandlung direkt ins Auge verlegen.
Das spart nicht nur Kosten, Material und Arztbesuche, sondern macht auch eine individuell auf die Patienten abgestimmte Therapie möglich. Man muss sich unsere Kontaktlinse wie eine Minifabrik vorstellen
, sagt del Campo. Sie besteht aus einem Hydrogel, in dem Bakterien eingeschlossen sind. Die Bakterien verbleiben im Material, während der von ihnen produzierte Wirkstoff die Linse verlassen kann und dann direkt vom Auge aufgenommen wird.
Die bakteriellen Wirkstoffproduzenten in der Linse können die Wissenschaftler gezielt hemmen oder antreiben. Sie stellen so sicher, dass Medikamente nur bei Bedarf freigesetzt werden – zum Beispiel, wenn ein Mangel besteht oder ein bestimmter Krankheitserreger in der Nähe ist.
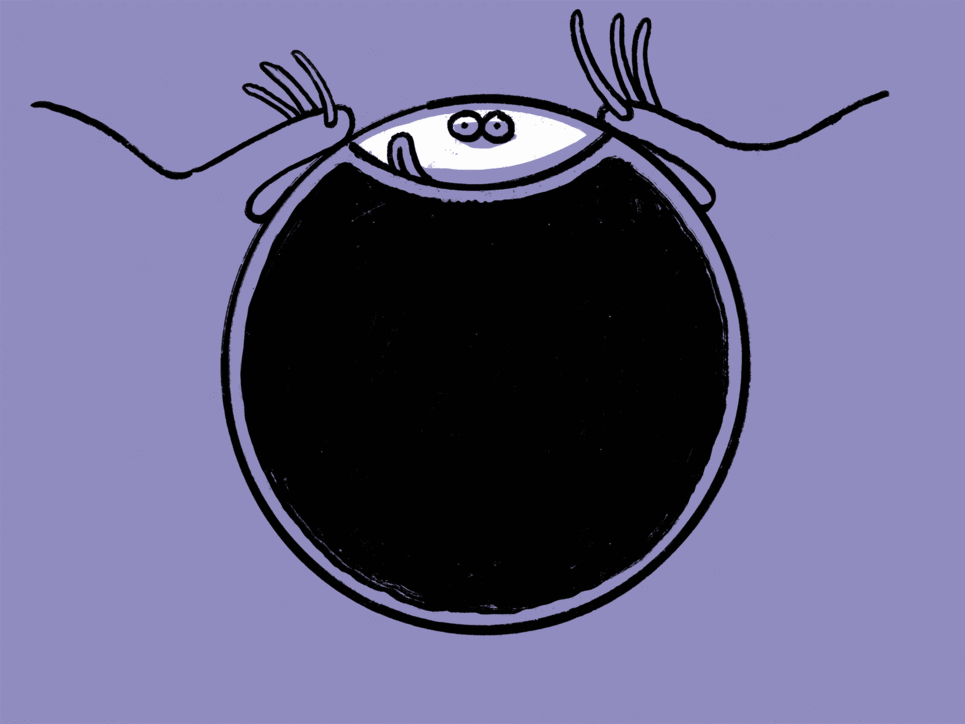
Merk-würdiger Wurz
Er riecht süßlich, schmeckt bitter und in Skandinavien und Osteuropa werden ihm gedächtnissteigernde Effekte nachgesagt. Ob der Rosenwurz tatsächlich in der Lage ist, uns besser lernen zu lassen, haben Leibniz-Forscher mit Hilfe komplexer Laborexperimente untersucht. Das Ergebnis: Der Wurz wirkt! Die größte Herausforderung für uns war, die wirksame Substanz aus der Vielzahl von Stoffen herauszufiltern, die in der Wurzel enthalten sind
, sagt Ludger Wessjohann vom Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie.
Denn Rosenwurzextrakte und -pulver sind zwar schon seit Langem auf dem Markt, doch zeigen nur wenige von ihnen auch die erhoffte Wirkung. Die Wissenschaftler isolierten zunächst aussichtsreiche Wirkstoffe aus der Gebirgspflanze, verfütterten sie an Tiere und dokumentierten anschließend deren Lernleistung. Die Testkandidaten: Maden, Fliegen, Bienen und Mäuse. Den Maden, Fliegen und Bienen haben wir beigebracht, einen Zusammenhang zwischen einem bestimmten Geruch und einer Zuckerbelohnung herzustellen. Die Mäuse sollten lernen, eine Gefahrensituation zu erkennen
, sagt Bertram Gerber vom Leibniz-Institut für Neurobiologie.
Seine Experimente zeigen, dass mit Wurzsubstanz gedopte, tierische Probanden ihre Aufgabe deutlich besser meistern als Vergleichsgruppen. Und insbesondere ältere Tiere können von einer Rosenwurz-Diät profitieren. Möglicherweise trifft das auch auf Menschen zu, sagt Bertram Gerber: Ob Mensch oder Tier – im Alter lässt die Lernleistung nach. Vielleicht können unsere Experimente einen Weg aufzeigen, insbesondere älteren Menschen den Alltag zu erleichtern.

Wehrhafter Pilz
Unkräuter und Ungräser sichern sich gerne ein Plätzchen an der Sonne und sorgen bei Bauern so für jede Menge Kopfzerbrechen. Auf Feldern entziehen sie dem Boden Nährstoffe und machen Mais, Weizen und Co. den Platz streitig. In Kollaboration mit anderen Schädlingen wie Käfern, verursachen Unkräuter und Ungräser jedes Jahr massive Ernteeinbußen – beim Weizen gehen weltweit bis zu 50 Prozent verloren, bei der Baumwolle sind es sogar bis zu 80 Prozent.
Am WissenschaftsCampus Halle hat ein Forscherteam vom Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB) und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) den pflanzlichen Mundräubern nun den Kampf angesagt. Mit der Entwicklung eines neuartigen Bio-Unkrautvernichters wollen sie den Verdrängungswettbewerb für die Kulturpflanzen entscheiden. Wir forschen an einem Pilz, der Stoffwechselprodukte erzeugt, die für Unkräuter und Ungräser hochgiftig sind und damit als biologische Herbizide bezeichnet werden können,
sagen Norbert Arnold vom IPB und Holger B. Deising von der MLU. Ein kleiner Tropfen des Pilzextraktes genügt, um die Blätter von Unkräutern vertrocknen zu lassen.
Gerade versuchen die Forscher, die chemische Struktur des Pilzgiftes zu entschlüsseln. Gelingt ihnen das, könnte es zur Basis eines neuartigen Mittels werden, das ungebetenen Feldgästen gezielt den Garaus macht. Anders als bei umstrittenen Substanzen wie Glyphosat, ist dieses Gift sozusagen evolutionär vorgeprüft
, beschreibt Norbert Arnold die Vorteile, eine in der Natur bereits vorhandene Lösung
im Labor weiterzuentwickeln. In einigen Jahren könnte das Pilzgift so als umweltfreundlicher, biologisch abbaubarer Unkrautvernichter helfen, weltweit Ernten zu sichern.
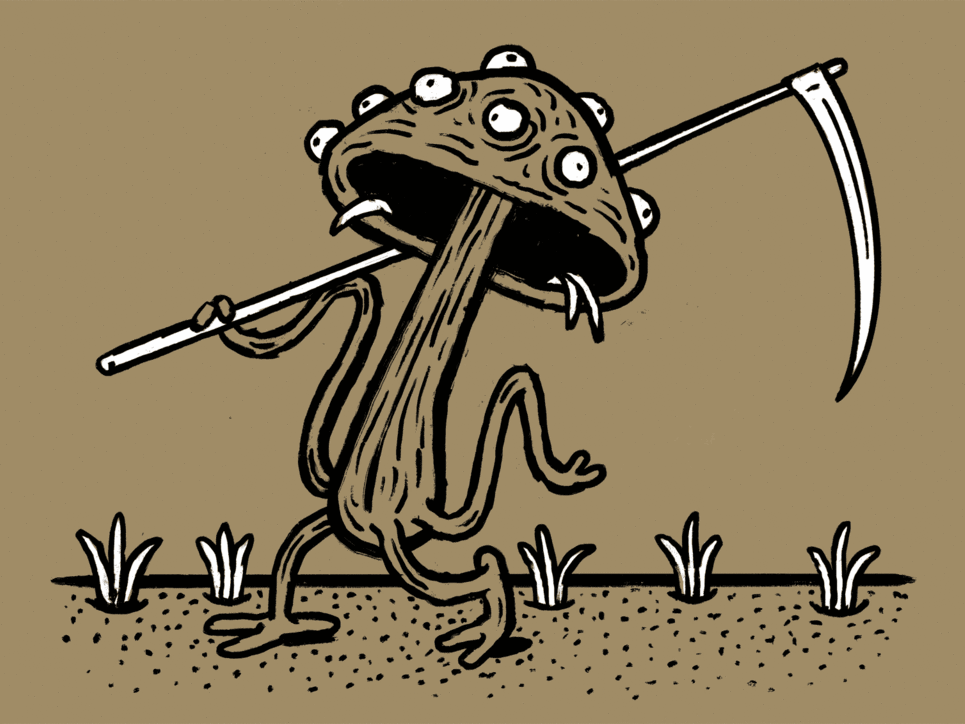
Wertvoller Müll
Er landet in der Tonne, verrottet auf Deponien oder heizt in Müllverbrennungsanlagen den Klimawandel an: Für die meisten Menschen ist Biomüll wertloser Abfall. Joachim Venus vom Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie jedoch sieht in ihm einen Schatz, den es zu bergen gilt. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen forscht der Experte für Bioverfahrenstechnik an Prozessen, Biomüll weiterzuverarbeiten. Orangenschalen, Fischgräten, Knochen und Kaffeefilter türmen sich dann nicht mehr zu Müllbergen auf, sondern werden zu Mülltüten, Folien und Verpackungen.
Biologische Reststoffe aus der industriellen Produktion und aus städtischen Siedlungsabfällen verflüssigen wir und gewinnen über eine Reihe von Zwischenschritten Milchsäure
, erklärt der Bioverfahrenstechniker. Diese farblose Flüssigkeit kann zum Bio-Kunststoff PLA weiterverarbeitet werden, der unter anderem als Gartenbaufolie Anwendung findet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Folien kann man die umweltfreundliche Kunststoffalternative PLA auf Feldern einfach unterpflügen. Die Folie löst sich dann auf und ihre Bestandteile finden wieder Eingang in den natürlichen Wertstoffkreislauf.
Joachim Venus‘ Vision: biologischen Abfall in Zukunft direkt dort zu PLA und anderen Stoffen weiterzuverarbeiten, wo er entsteht. Aus Molke in der Joghurtproduktion werden dann Joghurtbecher, aus Kartoffelschalen Chipstüten.