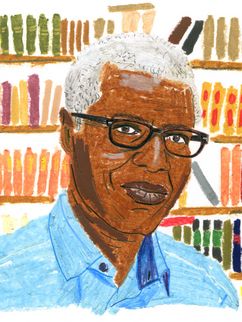LEIBNIZ Denkerinnen und Denker aus anderen Regionen der Welt spielen in den Lehrplänen deutscher Universitäten bislang kaum eine Rolle? Wie sind Sie dazu gekommen, sich mit sogenannter afrikanischer Philosophie zu beschäftigen?
KAI KRESSE Ich habe in meiner Kindheit viereinhalb Jahre in Südafrika verbracht und war später, nach dem Zivildienst, noch einmal für drei Monate in Ostafrika. Zu dem Kontinent hatte ich also schon früh einen Bezug. Im Studium habe ich dann beschlossen, mein Hauptfach Philosophie mit der Afrikanistik zu verbinden.
Begegneten Ihnen dort afrikanische Philosophinnen und Philosophen?
Hätte ich mich nicht aus eigenem Antrieb damit beschäftigt, wäre ich nicht mit ihnen in Kontakt gekommen. An deutschen Universitäten wurden und werden bis heute fast ausschließlich europäische und US-amerikanische Theorien gelehrt.
Sie mussten also selbst auf die Suche gehen.
Ich habe mir die Frage gestellt, welche philosophischen Traditionen es wohl in Afrika gibt. Den Philosophen Henry Odera Oruka habe ich dann während eines Ostafrika-Aufenthaltes von Sansibar aus angeschrieben, wo ich zum Zweck des Swahili-Studiums war. Im Anschluss hatte ich dann das Glück ihn persönlich kennenlernen und interviewen zu können. Ich muss aber auch sagen: Wenn ich in Deutschland auf Professoren zugegangen bin, waren sie zum Teil erstaunlich offen für meine Auseinandersetzung mit afrikanischen Denkerinnen und Denkern – auch wenn deren Theorien nicht in ihren Vorlesungen vorkamen.
Afrikanische Denktraditionen wurden lange als weniger rational angesehen.
Mit Henry Odera Oruka haben Sie sich später intensiv beschäftigt. Wofür steht er?
Es gab damals, in den 1970er Jahren, eine etwas festgefahrene Gegenüberstellung in der Debatte über afrikanische Philosophie: die sogenannte ethnophilosophische Schule und die akademischen Philosophen, die Odera Oruka selbst professional philosophers nennt. Erstere geht davon aus, dass Philosophie in Afrika aus kollektiven Mythologien besteht, während die akademische Philosophie der westlichen Welt auf kritischer Reflexion basiert. Odera Oruka dagegen sagt, dass wir den Philosophiebegriff in Afrika nicht von dem der restlichen Welt unterscheiden dürfen und wehrt sich gegen rassistische Denkmuster.
Welchen Philosophiebegriff hat er geprägt?
Er hat Feldforschung betrieben und Menschen in verschiedenen afrikanischen Gemeinschaften gefragt, wer dort als weise – im Englischen sagt man sage – angesehen wird. Er interviewte diese Weisen und dokumentierte ihre Aussagen, um sie der Welt zugänglich zu machen. In seiner »Sage Philosophy« geht er also von einzelnen Individuen aus und vertritt die Annahme, dass wir Philosophinnen und Philosophen potenziell überall finden können – nicht nur in Hörsälen, sondern auch in abgelegenen Dörfern.
Odera Oruka gilt als einer der Vorreiter der afrikanischen Philosophie. Birgt dieser Ausdruck nicht auch Gefahren?
Der Begriff ist tatsächlich ein Streitpunkt in der Debatte, die unter anderem Odera Oruka beschreibt. Und natürlich muss man aufpassen, dass »afrikanische Philosophie« nicht essentiell auf einzelne Merkmale reduziert und vereinheitlicht wird. Es ist wichtig, die Vielstimmigkeit und die Pluralität der philosophischen Konzepte aus ganz unterschiedlichen afrikanischen Kontexten im Blick zu behalten und sich konkrete Themenfelder und Begriffe anzuschauen.
Was für Begriffe sind das zum Beispiel?
Da wäre etwa das Wort »Ubuntu«, das eine ganze Lebensphilosophie bezeichnet. Übersetzt bedeutet es so viel wie Menschlichkeit. Letztlich ist damit aber noch viel mehr gemeint. Es geht darum, dass Menschen mit anderen Menschen in Verbindung stehen: Erst durch die soziale Beziehungen ist der Mensch ein Mensch. Dieses relationale Verständnis findet sich nicht nur im Süden Afrikas, sondern auch in ostafrikanischen Kontexten.

Woran liegt es, dass solche Konzepte nicht an deutschen Universitäten gelehrt werden?
Ich denke, dass eurozentristische Traditionen Stereotype dahinterstecken, die sich bis heute festgesetzt haben. Afrikanische Denktraditionen wurden zum Beispiel lange als weniger rational angesehen – was natürlich nicht stimmt. Sie sind außerdem weniger institutionalisiert, da sie oft außerhalb des modernen akademischen Kontexts bestehen. Eine Ursache abseits universitärer Strukturen ist letztlich auch einfach die Sprachbarriere: Es fehlen Menschen, die sprachlich qualifiziert sind, um sich mit afrikanischen oder auch asiatischen Theoretikerinnen und Theoretikern zu beschäftigen und sie zu übersetzen. In den 1990er Jahren gab es da zwar einen Aufschwung im Zuge der Bewegung der interkulturellen Philosophie. Trotz einiger Schritte nach vorn – ein Beispiel sind Übersetzungen im Suhrkamp Verlag – sind afrikanische Theorien aber bis heute nicht in der Mainstream-Philosophie angekommen.
Sie haben auch an Universitäten in den USA und in England studiert und gelehrt. Ist es dort anders?
Zumindest sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Globalen Süden präsenter. Ich denke, dass Theoretikerinnen und Theoretiker aus Asien und Afrika dort leichter Fuß fassen können, weil auf Englisch gelehrt wird und die anglophone Wissenschaftswelt somit offener für Menschen aus dem Ausland ist.
Werden auch in afrikanischen Ländern vorrangig westliche Theorien gelehrt?
Ja, auch an afrikanischen Universitäten werden kaum Theorien afrikanischer Denkerinnen und Denker durchgenommen. Auch dort wird vor allem europäische Philosophiegeschichte gelehrt. Und das ist ein Riesenproblem, weil so versäumt wird, ein positives Bewusstsein über und eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geistesgeschichte und ihren intellektuellen Traditionen zu kultivieren.
Wie kommt dieses Ungleichgewicht zustande?
Es ist vor allem eine Nachwirkung des Kolonialismus, dessen Strukturen sich auch darin zeigen, dass die Denktraditionen der ehemaligen Kolonialmächte noch immer vorherrschend sind. Dies haben afrikanische Intellektuelle immer wieder moniert, darunter Ngugi wa Thiong’o, Paulin Hountondji, Valentin Mudimbe, Kwasi Wiredu und viele andere. Auch aktuell gibt es Bestrebungen, das Ungleichgewicht auszubalancieren. Gerade in Nigeria und Südafrika laufen hierzu lebendige Diskussionen.
Auch an afrikanischen Universitäten wird vor allem europäische Philosophiegeschichte gelehrt.
Was würde helfen?
Das Problem ist nicht damit gelöst, dass gesagt wird: Wir konzentrieren uns jetzt auf afrikanische Philosophie als separate Tradition, die dann völlig losgelöst von der europäischen gelehrt wird. Das wäre wieder zu essentialistisch. Vielmehr hilft es, sich auf Konferenzen und in gemeinsamen Projekten auszutauschen. Ich suche deshalb immer wieder Gelegenheiten, um mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Regionen im Dialog zu bleiben. So haben wir am Leibniz-Zentrum Moderner Orient vor ein paar Jahren eine Arbeitsgruppe initiiert, in der wir in monatlichen Treffen mit Kolleg*innen aus Afrika, Südasien und dem Mittleren Osten diskutieren. Auch Berliner Kolleginnen und Kollegen von der Freien Universität und der Humboldt-Universität sind dabei.
Wie profitiert die Wissenschaft von so einem Austausch?
Wenn wir über den eigenen Tellerrand blicken und verschiedene Perspektiven wahrnehmen, ist das immer eine Bereicherung. Ich selbst habe mich langfristig in den Swahili-Kontext eingearbeitet und zusammen mit ostafrikanischen Kollegen öfter in Swahili verfasste Texte übersetzt. Das war sehr erkenntnisreich. Wenn wir einander unsere Arbeiten und Gedanken zugänglich machen, hilft das, wie der kenianische Schriftsteller und Kulturwissenschaftler Ngugi wa Thiong’o sagt, unser Denken zu dekolonialisieren.
Was bedeutet das?
Wenn unterrepräsentierte Stimmen stärker gehört und ihr Blick auf die Welt berücksichtig werden, verringert sich in diesem Prozess vielleicht auch die Machtdiskrepanz. Außerdem ist es immer gut, mehr darüber zu erfahren, wie die Welt jenseits von etablierten Strukturen gesehen werden kann. Das drückt sich schließlich in philosophischen Begriffen aus, kann aber auch Eingang in Bereiche wie Politik, Ethik und in die Gesellschaft finden.
Beschäftigen Sie sich in Ihrer Arbeit auch mit Ihrer eigenen Rolle als weißer Europäer?
Letztlich treibt mich das ständig um, denn es stellt sich die Frage, auf welche Weise ich in dieser Rolle konstruktiv arbeiten kann. Wenn wir versuchen, andere Positionen und Denkweisen zu verstehen, sind wir unterbewusst natürlich immer auch von Vorurteilen geprägt – darüber sollten wir uns klar sein, auch wenn wir durch Studium und Erfahrungen andere Perspektiven verstehen und uns aneignen können. Gerade deshalb bin ich auf den Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus anderen Kulturen angewiesen. Das Ganze kann nur als kollaboratives Projekt funktionieren. Als Wissenschaftler, der sich mit afrikanischer Philosophie und intellektuellen Traditionen aus Afrika beschäftigt, sehe ich mich dabei in einer Vermittlerposition.